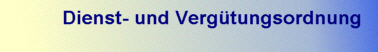
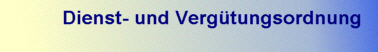 |
|
Inhaltsverzeichnis
0. Präambel
Teil I - Grundlegende Bestimmungen
1.
Beruf und kirchliche Stellung
- Das kirchliche Amt (1.1)
- Der Dienst des Diakons (1.2)
- Die Einheit des kirchlichen Amtes (1.3)
- Bezugsperson für Gemeinden (1.4)
- Einsatz des Diakons übergemeindlich/kategorial (1.5)
2.
Berufliche Aufgabenbereiche
- Bruderdienst (2.1)
- Verkündigung (2.2)
- Liturgischer Dienst (2.3)
3. Voraussetzungen für den Dienst
- Religiöse und kirchliche Voraussetzungen (3.1)
- Menschliche Voraussetzungen (3.2)
- Fachliche Voraussetzungen (3.3)
- Kirchenrechtliche Voraussetzungen (3.4)
- Lebensform (3.5)
- Einverständnis der Ehefrau (3.6)
- Referenzen (3.7)
4.
Ausbildung, Berufseinführung und Fortbildung (4)
- Organisationsstrukturen (--)
- Diakonatskreise und Diakonenkreise (4.1)
- Zulassungsschritte zur Diakonenweihe (4.2)
- Aufnahme in den Diakonatskreis
- Übertragung der Dienste
- Aufnahme unter die Kandidaten (Admissio)
- Weihegesuch/Skrutinium
- Weiheexerzitien
- Ausbildung, Berufseinführung und Fortbildung (DmZ) (4.3)
- Ausbildung zum Diakon mit Zivilberuf
(4.3.1)
- Fortbildung des Diakon mit Zivilberuf
(4.3.2)
- Ausbildung, Berufseinführung und Fortbildung (D.
im Hauptberuf) (4.4)
- Zugangswege (4.4.1)
- Fortbildung (4.4.2)
Teil II - Dienstrechtliche Bestimmungen
Dienstrechtliche Grundlagen
§ 1 - Rechtsnatur des kirchlichen Dienstverhältnisses
§ 2 - Anzuwendende Vorschriften
§ 3 - Beginn und Gestalt des kirchlichen Dienstverhältnisses
§ 4 - Tätigkeitsform des Diakons im Hauptberuf
§ 5 - Tätigkeitsform des Diakons mit Zivilberuf
§ 6 - Änderung der Tätigkeitsformen
§ 7 - Unvereinbarkeit von Tätigkeiten, Nebentätigkeiten
§ 8 - Ruhestand, Entpflichtung
§ 9 - Wechsel des kirchlichen Dienstverhältnisses
§ 10
- Beendigung des kirchlichen Dienstverhältnisses
Dienstrechtliche Einzelbestimmungen
§ 11 - Ernennung
§ 12 - Versetzung
§ 13 - Aufgabenumschreibung
§ 14 - Amtseinführung
§ 15 - Residenzpflicht, Dienstwohnung, Dienstzimmer
§ 16 - Zeitliche Gestaltung des Dienstes
§ 17 - Fortbildung
§
18 - Urlaub, Dienstbefreiung
§ 19 - Zusammenarbeit
§ 20 - Gemeinschaft mit anderen SeelsorgerInnen
§ 21 - Diakonenkreis, Standesvereinigung
§ 22
- Beschwerden, Konfliktlösung
Vergütung und Versorgung der Diakone im Hauptberuf
§ 23 - Grundsätzliche Regelung
§ 24 - Vergütung
§ 25 - Krankenversicherung, Beihilfe
§ 26 - Versorgung
§ 27 - Übergangsregelungen
§ 28 - Inkrafttreten
Anlage 1 zum § 24 - Vergütung - der Bayerischen Dienstordnung
Anlage 2 Urlaubsregelungen für hauptberufliche Ständige Diakone (Teil II, § 18)
Anlage 3
zu Teil I Ziffer 4 - Ausbildung, Berufseinführung
und Fortbildung - der Rahmenordnung der DBK und der Bayerischen Dienstordnung
Ausführungsbestimmungen und Erläuterungen zur Dienst- und Vergütungsordnung für Ständige Diakone vom 1. Juli 2000
Präambel
In textlicher Übereinstimmung mit der am 24. Februar 1994 von den deutschen Bischöfen verabschiedeten „Rahmenordnung für Ständige Diakone in den Bistümern der Bundesrepublik Deutschland“[1] und zu ihrer Konkretisierung wird für die Ständigen Diakone in den bayerischen (Erz-)Diözesen folgende Dienst- und Vergütungsordnung erlassen[2].
Teil I - Grundlegende Bestimmungen
1. Beruf und kirchliche Stellung
1.1 Das kirchliche Amt vollzieht in seiner dreifachen Ausformung von Episkopat, Presbyterat und Diakonat öffentlich im Namen Christi den Auftrag der Verkündigung des Gotteswortes, der Heiligung der Gläubigen und des Bruderdienstes. Bischöfen, Priestern und Diakonen ist es aufgegeben, in amtlicher Vollmacht durch ihr Wort und ihr Tun den Herrn zu vergegenwärtigen, der „gekommen ist, nicht um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen“ (Mk 10,45), und alle zum Dienen berufen hat.
Es gibt viele Dienste in der Kirche, durch die der Herr seine Kirche aufbaut. Dem Diakonat, „der in der Kirche stets in hohem Ansehen gestanden hat“ (Ad Pascendum), ist es eigen, dass er dem kirchlichen Amt zugehört. Dieser Dienst setzt eine spezifische Berufung voraus; er wird durch die Spendung des Weihesakramentes übertragen. Gebet und Handauflegung des Bischofs verleihen dem Diakon über Taufe und Firmung hinaus eine besondere Gabe des Geistes. Das Zweite Vatikanische Konzil hat den Diakonat als festen und dauerhaften Lebensstand erneuert: „Denn es ist angebracht, dass Männer, die tatsächlich einen diakonalen Dienst ausüben, ... durch die von den Aposteln her überlieferte Handauflegung gestärkt und dem Altare enger verbunden werden, damit sie ihren Dienst mit Hilfe der sakramentalen Diakonatsgnade wirksamer erfüllen können“ (Ad Gentes 16; vgl. Sacrum Diaconatus Ordinem, Einführung). Der Diakon ist Zeichen des dienenden Christus und der dienenden Kirche. Aus der sakramentalen Verbindung mit Christus soll er „dem Volk Gottes in der Diakonie der Liturgie, des Wortes und der christlichen Bruderliebe in Gemeinschaft mit dem Bischof und seinem Presbyterium“ (Lumen Gentium 29) dienen. Mit dem Priester gilt der Diakon seit alters her als Helfer des Bischofs (vgl. Lumen Gentium 20). Seine Aufgaben werden ihm vom Bischof übertragen (vgl. Sacrum Diaconatus Ordinem 22).
1.2 Seinen spezifischen Dienst nimmt der Diakon kraft des Weihesakramentes in amtlicher Sendung und Vollmacht wahr. Der Codex Iuris Canonici bestimmt: „Durch das Sakrament der Weihe werden kraft göttlicher Weisung aus dem Kreis der Gläubigen einige mittels eines untilgbaren Prägemals, mit dem sie gezeichnet werden, zu geistlichen Amtsträgern bestellt; sie werden ja dazu geweiht und bestimmt, entsprechend ihrer jeweiligen Weihestufe die Dienste des Lehrens, des Heiligens und des Leitens in der Person Christi, des Hauptes, zu leisten und dadurch das Volk Gottes zu weiden“ (can. 1008). „Die Weihen sind Episkopat, Presbyterat und Diakonat“ (can. 1009 § 1). Innerhalb der einen Sendung des kirchlichen Amtes kommt es dem Diakon zu, die Liebe Christi zu denen hinzutragen, die einer Hilfe besonders bedürfen. Alle seine „Aufgaben sind in vollkommener Gemeinschaft mit dem Bischof und seinem Presbyterium auszuüben“ (Sacrum Diaconatus Ordinem 23). Für seinen Gemeindedienst ist der Diakon dem Priester verantwortlich, der am betreffenden Ort die Leitung der Seelsorge hat; für eigenständig wahrzunehmende Aufgabenbereiche, die ihm auf regionaler und diözesaner Ebene übertragen werden, ist er dem jeweiligen Träger des Leitungsamtes verantwortlich.
„Gleichsam als Anwalt der Nöte und Wünsche der christlichen Gemeinschaften, als Förderer des Dienstes oder der Diakonie bei den örtlichen christlichen Gemeinden, als Zeichen oder Sakrament Christi des Herrn selbst, der nicht gekommen ist, sich bedienen zu lassen, sondern zu dienen“ (Ad Pascendum), soll der Diakon in der Gemeinde diakonische Dienste anregen und heranbilden. Auch soll er durch sein Leben und Wirken zur Evangelisierung der Lebensbereiche beitragen. Zugleich weiß er sich zu denen gesandt, die es an die Gemeinde heranzuführen gilt. Selbst in der Gemeinde stehend, hat er eine vorbereitende, vermittelnde, auf die Mitte der Gemeinde hinführende Aufgabe: Er formt lebendige Zellen brüderlicher Gemeinschaft und hilft mit, dass sich aus ihnen Gemeinde aufbaut. Sein Dienst zielt darauf, in der ganzen Gemeinde den Sinn für die Diaconia Christi zu wecken und wachzuhalten.
1.3 Die Einheit des kirchlichen Amtes muss im Dienst des Diakons ihren Ausdruck darin finden, dass er jeweils in allen drei Grunddiensten tätig ist: der Diakonie der Liturgie, der Verkündigung und der christlichen Bruderliebe. In seinem liturgischen Dienst wird sichtbar, dass Gottesdienst und Bruderdienst zusammengehören. Die Tätigkeit des Diakons kann daher nicht auf eine einzelne Aufgabe eingeengt werden. Dies muss bei der Prüfung der Berufung und bei der Ausbildung berücksichtigt werden.
Als Amtsträger weiß der Diakon sich der ganzen Gemeinde und der Kirche verpflichtet. Er arbeitet eng mit den anderen Diensten zusammen.
1.4 Während es in die originäre Zuständigkeit des Diakons fällt, Bezugsperson zu sein für vorgemeindliche und innergemeindliche Strukturen, sollen Diakone nur in Notsituationen und in begrenztem Ausmaß eingesetzt werden als Bezugspersonen für Gemeinden, solange sie keinen eigenen Priester am Ort haben. In diesen Fällen muss deutlich bleiben, dass tatsächlich ‑ und nicht nur rechtlich ‑ die Leitung der Gemeinde in der Hand des Priesters liegt. Das Berufsprofil des Diakons darf durch solche vorübergehenden Beauftragungen in Notsituationen nicht überfremdet werden.
1.5 Der Diakon kann auf allen Ebenen des pastoralen Dienstes von der Gemeinde bis zum Bistum eingesetzt, er kann auch zu bestimmten kategorialen Diensten bestellt werden. Der Diakonat kann hauptberuflich oder in Verbindung mit einem Zivilberuf ausgeübt werden. Die kirchliche Stellung des hauptberuflichen Diakons wie des Diakons mit Zivilberuf wird durch die Bezeichnung „Ständiger Diakon“ zum Ausdruck gebracht. Zur Diakonenweihe können nach den geltenden kirchlichen Bestimmungen nur Männer zugelassen werden.
2. Berufliche Aufgabenbereiche
Jeder Diakon ist in allen drei Grunddiensten tätig: in der Diakonie der christlichen Bruderliebe, des Wortes und der Liturgie.
Die Ausübung seines Dienstes in der Liturgie und in der Verkündigung wie auch sein Bruderdienst sollen von der Diaconia Christi geprägt sein. Sein diakonischer Auftrag weist ihm eine Brückenfunktion zu: Sein Platz ist zugleich in der Mitte der Gemeinde und dort, wo Gemeinde noch nicht oder nicht mehr ist. Aus den im folgenden genannten Bereichen ergeben sich für den Diakon je nach den pastoralen Strukturen und Erfordernissen und entsprechend seiner Ausbildung und Eignung die Schwerpunkte seiner Tätigkeit, die in seiner Stellenbeschreibung näher umrissen werden. Auf welcher pastoralen Ebene ein diakonaler Dienst erforderlich und ob er hauptberuflich oder in Verbindung mit einem Zivilberuf auszuüben ist, bestimmt sich von Umfang und Eigenart der anfallenden diakonalen Aufgaben her. Dem Diakon mit Zivilberuf ist es in besonderer Weise aufgegeben, in der beruflichen Welt die Diaconia Christi durch Leben und Wort zu bezeugen.
2.1 Durch seinen Bruderdienst soll der Diakon in amtlicher Vollmacht und Sendung besonders den Hilfsbedürftigen die Liebe Christi bezeugen. Zu diesem Auftrag gehören u. a. folgende Aufgaben: Bildung von Zellen und Gruppen brüderlicher Gemeinschaft; Entdeckung und Förderung von Charismen und Talenten zum Aufbau brüderlicher Gemeinde; Hinführung von Einzelnen und Gruppen sowie Öffnung vorgemeindlicher Strukturen zur Mitte der Gemeinde hin; Öffnung der Gemeinde für besondere Anliegen, Anfragen und Nöte der Menschen; Sorge für Menschen in Sondersituationen, wie Kranke, Behinderte, Vereinsamte, Aussiedler, Neubürger, Ausländer; Hilfe in sozialen Problemsituationen; Sorge für Menschen am Rande von Gesellschaft und Kirche; Anregung und Weckung diakonischer Dienste; Unterstützung und Förderung katholischer Verbandsarbeit; Kooperation mit kirchlichen und kommunalen Einrichtungen im Bereich der Caritas und des Sozialwesens.
2.2 Durch seinen Dienst am Wort soll der Diakon die Gemeindeglieder im Glauben stärken, sie zu gemeinsamer Erfahrung des Glaubens hinführen und zu gemeinsamem Zeugnis des Glaubens ermutigen. Zu diesem Auftrag gehören u. a. folgende Aufgaben: Glaubenszeugnis und Glaubensgespräche mit Einzelnen und in Gruppen ‑ besonders mit Menschen in geistlicher und materieller Not; Milieuseelsorge etwa am Arbeitsplatz, unter Zielgruppen; Ansprache bei Wortgottesdiensten; Predigt in der Eucharistiefeier; Mitwirkung in der Vorbereitung auf den Sakramentenempfang; Mitwirkung in der Gemeindekatechese; Befähigung von Eltern und anderen Erwachsenen zur Einführung der Kinder in den Glauben; Erteilung von schulischem Religionsunterricht.
2.3 Durch seinen Dienst in der Liturgie, insbesondere in der Eucharistiefeier, bekundet der Diakon, dass Gottesdienst und Bruderdienst eine untrennbare Einheit bilden und dass der Bruderdienst ein Wesenselement christlichen Gemeindelebens und eine zentrale Aufgabe aller christlichen Amtsträger ist. Außer der Verkündigung im Gottesdienst obliegen dem Diakon im Bereich der Liturgie folgende Aufgaben: Assistenz in der Eucharistiefeier; Spendung der Eucharistie auch außerhalb der Messe (besonders an Kranke und Sterbende); Leitung der Feiern von Taufe, Trauung und Begräbnis; Leitung von Wortgottesdiensten und Segnungsfeiern; Mitwirkung bei der Vorbereitung und Gestaltung von Gottesdiensten; Heranbildung und Begleitung von Mitarbeitern und Helfern für Gottesdienste[3].
3. Voraussetzungen für den Dienst
Für den Dienst als Diakon müssen bestimmte religiöse und kirchliche, menschliche und fachliche Voraussetzungen gegeben sein.
3.1 Religiöse und kirchliche Voraussetzungen sind Bereitschaft zur Nachfolge des Herrn, der Diener aller geworden ist, persönliche Gläubigkeit, Übereinstimmung mit der Glaubenslehre und der Lebensordnung der katholischen Kirche, aktive Teilnahme am Leben einer Gemeinde, Bereitschaft zum täglichen Gebet, insbesondere zum Gebet der Kirche (verpflichtend Laudes und Vesper gem. Beschluss der Deutschen Bischofskonferenz zu c. 276 § 2 n. 3 CIC), zur regelmäßigen Schriftlesung, zur häufigen Mitfeier der Eucharistie auch an Werktagen und zum regelmäßigen Empfang des Bußsakramentes, Bemühen um religiöses Familienleben, Vertrautsein mit den Formen der Volksfrömmigkeit und mit religiösem Brauchtum, Erfahrung in ehrenamtlichen pastoralen und diakonalen Aufgaben, Bereitschaft, von Christus durch die Kirche endgültig in Dienst genommen zu werden.
Diese religiösen Voraussetzungen und die entsprechende Glaubenspraxis, die Motivation für den Ständigen Diakonat und die Einstellung des Interessenten zur Kirche in ihrer konkreten Gestalt sind vor der Entscheidung über eine Annahme als Interessent zu erheben. Auf die Bereitschaft, menschlich und religiös zu wachsen und zu reifen, ist zu achten. Extreme religiöse Einstellungen sind dem Dienst eines Ständigen Diakons abträglich. Ein mehrjähriges kirchliches Engagement, vor allem in der Gemeinde, ist Voraussetzung.
Der Klärung von Berufung, Motivation und Kirchlichkeit dienen Gespräche mit den Verantwortlichen für den Ständigen Diakonat in der (Erz-) Diözese; kirchliche Beratungsdienste können eingeschaltet werden.
Ist der Interessent Konvertit, muss er in der katholischen Kirche ausreichend eingewurzelt sein; als Anhalt dient ein Zeitraum von mindestens drei Jahren vor Annahme als Interessent.
3.2 Menschliche Voraussetzungen sind die für den Beruf erforderliche körperliche und seelische Gesundheit, bei Verheirateten Bewährung in Ehe und Familie, bei Berufstätigen Berufsbewährung, Bereitschaft und Fähigkeit, auf leibliche und seelische Nöte der Mitmenschen zuzugehen, Urteilskraft, Fähigkeit zur Wahrnehmung eigener Verantwortung, Bereitschaft zu einem einfachen Lebensstil, Bereitschaft und Fähigkeit zur Zusammenarbeit mit anderen haupt- und nebenberuflichen sowie ehrenamtlichen Diensten.
Bei verheirateten Interessenten sind vor ihrer Annahme mindestens drei Jahre als Zeit für die Bewährung in Ehe/Familie Voraussetzung. Eine religionsverschiedene Ehe schließt nach derzeitiger Regelung die Zulassung zum Ständigen Diakonat aus; bei konfessionsverschiedener Ehe liegt diese im Ermessen des Ordinarius[4].
Bei Interessenten, die zölibatär leben wollen, wird eine mehrjährige Bewährung in dieser Lebensform vorausgesetzt. Eine geistliche Begleitung ist Bedingung; die Möglichkeit hierzu ist zu schaffen.
Lebensweise und persönlicher Aufwand müssen in einem angemessenen Verhältnis zum Dienst eines Ständigen Diakons stehen, damit sein Zeugnis für das Evangelium glaubwürdig bleibt.
Auf eine abgeschlossene Berufsausbildung und eine angemessene Kontinuität in der beruflichen Tätigkeit ist zu achten. Die zivilen Berufe oder Tätigkeiten dürfen nicht den Grundsätzen von Teil II, § 6 „Unvereinbarkeit mit anderen Tätigkeiten, Nebentätigkeiten“ widersprechen.
Der Diakon mit Zivilberuf soll zum Zeitpunkt der Weihe in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis stehen.
Bewerber für den hauptberuflichen Dienst als Diakon müssen bis zum Zeitpunkt der Weihe eine Tätigkeit ausüben, die ihren Unterhalt gewährleistet und den Grundsätzen von Teil II, § 6 „Unvereinbarkeit mit anderen Tätigkeiten, Nebentätigkeiten“ entspricht.
Bei Interessenten, Bewerbern oder Kandidaten ohne Beschäftigungsverhältnis bedarf es einer eingehenden Einzelfallprüfung. Diese muss besonders die Arbeitsmarktlage, die Bereitschaft und die Möglichkeit zur beruflichen Umorientierung ins Auge fassen.
3.3 Die fachlichen Voraussetzungen sind:
- mindestens der mittlere Schulabschluss oder eine vergleichbare Ausbildung,
- ein erfolgreicher Abschluss der vorgeschriebenen theologischen Studien und
- der pastoral-diakonischen Kurse und Praktika.
Auch muss der Bewerber mindestens drei Jahre Mitglied eines Diakonatskreises gewesen sein und darin regelmäßig und aktiv mitgearbeitet haben.
Nach mehrjähriger hauptberuflicher Tätigkeit in einem pastoralen Dienst kann die Teilnahme am Diakonatskreis bis auf zwei Jahre verringert werden. Diese zeitlich verringerte Teilnahme ist Interessenten aus pastoralen Berufen nur nach der 2. Dienstprüfung möglich. Die Entfaltung der Spiritualität eines zukünftigen Diakons bildet dann den Schwerpunkt.
3.4 Gemäß den Bestimmungen des can. 1031 § 2 CIC gelten für die Aufnahme unter die Weihekandidaten folgende kirchenrechtliche Voraussetzungen:
Verheiratete Bewerber müssen zur Weihe mindestens 35 Jahre alt sein; der Bischof kann jedoch in Einzelfällen das Weihealter um 12 Monate herabsetzen (gem. can. 1031 § 4 CIC). Für unverheiratete Bewerber, die sich zur Ehelosigkeit verpflichten, ist das Mindestalter auf 25 Jahre festgelegt.
Junge Interessenten am Ständigen Diakonat, die sich zur Ehelosigkeit verpflichten wollen, haben während der Ausbildungszeit mindestens drei Jahre lang in einem vom Diözesanbischof bestimmten Haus (Seminar, Pfarrhaus, Ordenshaus o.ä.) zu wohnen, wenn der Diözesanbischof nicht aus schwerwiegenden Gründen anders bestimmt (gem. Beschluss der Deutschen Bischofskonferenz zu can. 236 CIC).
Ein unverheirateter Bewerber für den Ständigen Diakonat darf zur Weihe erst zugelassen werden, wenn er nach dem vorgeschriebenen Ritus öffentlich vor Gott und der Kirche die Zölibatsverpflichtung übernommen bzw. die ewigen Gelübde in einem Ordensinstitut abgelegt hat (gem. can. 1037 CIC).
Darüber hinaus gilt:
Der Bewerber um den hauptberuflichen Diakonat soll zum Zeitpunkt der Weihe in der Regel nicht älter als 50 Jahre sein, der Diakon mit Zivilberuf nicht älter als 55 Jahre.
Bei Interessenten, die das nötige Mindestalter noch nicht erreicht haben, soll deren Interesse durch eine seelsorgerliche Begleitung wachgehalten und gefördert werden.
3.5 Voraussetzung für den Dienst als Diakon ist eine im Glauben angenommene und gestaltete Lebensform. Verheiratete und unverheiratete Diakone sollen in ihrem persönlichen Lebenskreis glaubwürdige Zeugen der Frohen Botschaft sein. Die verschiedenen Lebensformen bezeugen miteinander und in je spezifischer Weise die unerschöpfliche Liebe Gottes zu den Menschen.
Der Verheiratete soll Ehe, Familie und Dienst aus der von Jesus Christus vorgelebten Liebe heraus in eine fruchtbare Einheit bringen.
Die Anforderungen an die Lebensform des verheirateten Diakons sollen den Richtlinien über die persönlichen Anforderungen an Diakone und Laien entsprechen[5].
Ein Diakon, der „um des Himmelreiches willen“ (Mt 19,12) auf die Ehe verzichtet, soll diese Lebensform als Zeichen seiner Liebe zu Jesus Christus und zu den Brüdern und Schwestern verwirklichen.
3.6 Voraussetzung für die Weihe Verheirateter ist das schriftliche Einverständnis der Ehefrau mit der Übernahme des Diakonats (gem. can. 1031 § 2 CIC). Es ist notwendig, dass die Ehefrau den Dienst des Diakons bejaht und ihn nach Kräften mitträgt. Im übrigen gelten die in Ziff. 3.5 genannten Grundsätze.
Ihr Einverständnis soll die Ehefrau bereits beim Eintritt ihres Mannes in den Diakonatskreis und erneut vor der Weihe schriftlich erklären. Bei der Befragung im Weiheritus soll es öffentlich bekundet werden.
3.7 Um ein Urteil über die religiösen und kirchlichen Voraussetzungen sowie die aus dem Glauben gestaltete Lebensform zu ermöglichen, hat jeder Interessent mindestens zwei kirchlich gesinnte Personen zu benennen, die über ihn eine Referenz abgeben. Eine davon soll der Heimatpfarrer erstellen, wobei die Meinung des Pfarrgemeinderates in angemessener Weise zu berücksichtigen ist.
Vor der Entscheidung des Bischöflichen Beauftragten über die Aufnahme unter die Interessenten können weitere Vertrauenspersonen um eine Beurteilung gebeten werden.
Nach Klärung aller Voraussetzungen trifft der Bischöfliche Beauftragte die Entscheidung über die Annahme als Interessent.
4. Ausbildung, Berufseinführung und Fortbildung
Die Hinführung zum Diakonat geschieht zum einen durch die theologische und pastoral‑diakonische Ausbildung (in der Regel an den entsprechenden Ausbildungsstätten), sie geschieht zum anderen in den Diakonatskreisen, die vor allem der menschlichen und geistlichen Formung zum Diakonat dienen. Der Bischof bestellt einen Bischöflichen Beauftragten für den Diakonat. Dieser ist verantwortlich für die Anlage der Ausbildung, er muss auch gegenüber dem Bischof die Eignung des Bewerbers für den Diakonat beurteilen. In regelmäßigen Abständen soll er mit den Bewerbern ein Gespräch führen. Soweit der Bischöfliche Beauftragte die Leitung eines Diakonatskreises nicht selber wahrnimmt, überträgt der Bischof sie einem Leiter (Priester oder Diakon). Dieser soll nicht zugleich Regens für Priesterkandidaten sein.
Ferner bestellt der Bischof für jeden Diakonatskreis einen Priester zur Hilfe bei Glaubens- und Lebensfragen und bei der Klärung der Berufung sowie zur Förderung der geistlichen Ausrichtung des Diakonatskreises (Geistlicher Berater). Er soll den Mitgliedern des Diakonatskreises zu persönlichen Gesprächen zur Verfügung stehen und dem Diakonatskreis Hilfen zur Einführung und Einübung in das geistliche Leben geben. Zur Stellungnahme über die Eignung zum Diakon wird er nicht herangezogen.
Ein Leiter und ein Geistlicher Berater können auch mehrere Kreise betreuen.
Bei der Ausbildung, der Berufseinführung und der Fortbildung soll den Ehefrauen Gelegenheit gegeben werden, an den entsprechenden Veranstaltungen teilzunehmen. Bestimmte Veranstaltungen, insbesondere im geistlichen Bereich, sollen ausdrücklich die Familien berücksichtigen. Diese vielfältigen Kontakte der Diakone und ihrer Familien helfen mit, die durch die Weihe sakramental begründete Bruderschaft der Diakone wirksam zu leben.
Diese Aufgaben erfordern eine bestimmte Organisationsstruktur:
1. Die (Erz-)Diözese trägt die Verantwortung für die
- Nachwuchswerbung,
- Auswahl und Annahme der Interessenten/Bewer-ber/Kandidaten,
- Ausbildung zum Ständigen Diakon,
- Planung und Zuweisung der Tätigkeit nach der Weihe,
- Berufseinführung und Fortbildung,
- persönliche Begleitung und dienstliche Führung.
2. Für die Förderung des Ständigen Diakonates in den bayerischen (Erz-)Diözesen
- wird ein Bischöflicher Beauftragter bestellt,
- wird, wo nötig, ein Fachbereichs-/Arbeitsstellenleiter für den Ständigen Diakonat ernannt,
- kann dem Personalreferat die Organisation der oben genannten Aufgaben übertragen werden (analog zu anderen kirchlichen Berufsgruppen),
- wird eine Diakonatskommission eingerichtet,
- werden Diakonatskreise für die Zeit der Ausbildung und Diakonenkreise nach der Weihe gebildet,
- wird dem Bischöflichen Beauftragten gegebenenfalls ein Aus- und/oder Fortbildungsleiter zur Seite gestellt,
- ist für die spirituelle Begleitung der Interessenten/Bewerber/Kandidaten sowie der Ständigen Diakone und ihrer Familien zu sorgen,
- ist ein Sprecherrat der Ständigen Diakone zu wählen. Die Ehefrauen der Ständigen Diakone wählen zwei Vertreterinnen aus ihrem Kreis; sie gelten als Ansprechpartnerinnen und können zu Sitzungen eingeladen werden.
3. Die Landeskonferenz der Bischöflichen Beauftragten, Fachbereichs-/Arbeitsstellenleiter und Sprecher der Ständigen Diakone („Bayernkonferenz“) berät gemeinsame Belange und erarbeitet Vorschläge für die bayerischen (Erz-)Diözesen und die Konferenz der bayerischen Bischöfe.
4.1
Diakonats- und Diakonenkreise
4.1.1 Die Diakonatskreise haben ein vierfaches Ziel: Einführung in das geistliche Leben, Klärung der Berufung, Austausch von Erfahrungen, Hilfe bei der Ausbildung.
Jedes Treffen der Diakonatskreise bedarf einer ausdrücklichen geistlichen Prägung. Geeignete Formen sind: gemeinsames Gebet, insbesondere Stundengebet, Meditation, Glaubens- und Schriftgespräch, Eucharistiefeier. Gelegentlich sollen die Diakonatskreise auch Einkehrtage, geistliche Wochenenden, geistliche Wochen und Exerzitien anbieten. Neben der Einübung und Vertiefung des geistlichen Lebens aus der Grundhaltung der Diaconia Christi soll der Diakonatskreis auch Hilfe sein zur menschlichen Reifung und aus den Kandidaten, die meist unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen und auf verschiedenen Zugangswegen zum Diakonat ausgebildet werden, eine brüderliche Gemeinschaft formen.
Die Mitarbeit im Diakonatskreis soll dem Einzelnen helfen, die Frage seiner persönlichen Berufung zu klären. Die Entscheidung über die Zulassung zur Diakonenweihe liegt beim Bischof.
Der Erfahrungsaustausch im Diakonatskreis soll die unterschiedlichen beruflichen Einsatzfelder einbeziehen. Die Mitglieder des Diakonatskreises werden ihre Erfahrungen aus den Praktika, der Leiter und bereits im Einsatz stehende Diakone ihre Berufserfahrung einbringen.
Der Bewerber soll im Diakonatskreis eine Unterstützung seiner theologischen Ausbildung und andere Ausbildungselemente erfahren. Eine Hilfe bei der Ausbildung ist auch die gemeinsame Erarbeitung einzelner Themen, die im Hinblick auf den kommenden Dienst ausgewählt werden. Diese Hilfe in den Diakonatskreisen kann sich auf die Durchführung sowohl theologischer als auch pastoral-praktischer Themenbereiche erstrecken.
4.1.2 Ein Kreis soll möglichst nicht mehr als 15 Mitglieder zählen. Zu bestimmten Themen sollen gelegentlich Diakone eingeladen werden. Die Diakonatskreise treffen sich mindestens monatlich. Eine territoriale Gliederung der Kreise wird empfohlen.
Der Kreis wählt einen Sprecher. Zusammen mit dem Bischöflichen Beauftragten bzw. mit dem Leiter ist er verantwortlich für die Organisation der Treffen und für die Vertretung des Kreises.
4.1.3 Neben den Kreisen für Bewerber während der Zeit der Ausbildung (Diakonatskreise) sollen entsprechende Kreise für Diakone gebildet werden (Diakonenkreise). Ziel dieser Kreise sind Vertiefung des geistlichen Lebens, Austausch von Erfahrungen, Hilfe bei der Fortbildung.
Solange eine solche Trennung nicht sinnvoll ist, können beiderlei Kreise zusammengelegt werden.
Die Ziffern 4.1.1 und 4.1.2 „Diakonatskreise“ gelten sinngemäß auch für Diakonenkreise unter Beachtung folgender Aspekte:
1. Besondere Ziele ihrer Arbeit sind:
- Entwicklung und Entfaltung einer diakonischen Spiritualität,
- Vertiefung und Erweiterung der sozial-diakonischen Sensibilität und Kompetenz sowie des theologischen Fundamentes,
- Anregung und Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen,
- Reflexion der beruflichen Praxis sowie Hilfe bei der Dienstausübung durch Rat und Tat,
- Pflege eines geschwisterlichen Umgangs unter den Ständigen Diakonen und ihren Familien.
2. Die durchschnittliche Stärke eines Kreises sollte etwa 10 Ständige Diakone umfassen; die Ehefrauen können zu den Treffen eingeladen werden.
3. Eine regionale Gliederung ist jeder anderen vorzuziehen.
4. Jeder Kreis ist offen für alle in der Region eingesetzten Ständigen Diakone.
Der Diakonenkreis hat Vorrang vor Zusammenschlüssen zur Fortbildung und geistlichen Vertiefung, in denen sich Ständige Diakone auch zusammenfinden können.
5. Die Kreise sollen sich mindestens viermal jährlich treffen.
6. Jeder Kreis schlägt dem (Erz-)Bischof einen Priesterlichen Beirat vor, den jener für die Dauer von vier Jahren ernennt. Verlängerung ist möglich. Der Priesterliche Beirat soll den Kontakt mit dem Presbyterium aufrechterhalten und spirituelle wie pastorale Impulse geben.
7. Jeder Kreis wählt einen Sprecher.
Vgl. zu Ziff. 4.1.3 auch Teil II, § 21 (1).
4.2
Zulassungsschritte zur Diakonenweihe
Wichtige Schritte zur Diakonenweihe sind die Aufnahme in den Diakonatskreis, die Beauftragung zu den Diensten des Lektors und des Akolythen, die Admissio und die unmittelbare Vorbereitung auf die Weihe.
4.2.1 Nach einem Gespräch mit dem Bischöflichen Beauftragten und nach der Vorlage sämtlicher Personalunterlagen sowie einer Referenz des Heimatpfarrers erfolgt durch den Bischöflichen Beauftragten die Aufnahme in den Diakonatskreis. Der Bischöfliche Beauftragte beginnt mit jedem Einzelnen die Frage der Berufung und der grundsätzlichen Eignung zum Diakonat zu klären. Falls hinsichtlich eines Bewerbers Bedenken bestehen, ist ihm dies so früh wie möglich mitzuteilen und ggf. über sein Verbleiben im Diakonatskreis zu entscheiden. Vgl. Teil I, Ziff. 3 „Voraussetzungen für den Dienst“.
Das Gespräch mit dem Interessenten kann an den Fachbereichs-/Arbeitsstellenleiter delegiert oder in dessen Anwesenheit geführt werden.
4.2.2 Nach einjähriger Bewährung im Diakonatskreis werden den Bewerbern die Dienste des Lektors und des Akolythen übertragen. Der Bischöfliche Beauftragte schlägt die Bewerber dem Bischof vor.
4.2.3 Etwa ein Jahr vor der Weihe erteilt der Bischof die Admissio, die „Aufnahme unter die Kandidaten“. Der Bischöfliche Beauftragte schlägt dem Bischof die Kandidaten vor.
4.2.4 Gegen Ende der Ausbildung bitten die Kandidaten in einem schriftlichen Gesuch den Bischof um die Diakonenweihe. Vor der Weihe muss die Ausbildungsphase abgeschlossen sein. Der Bischöfliche Beauftragte schlägt dem Bischof die Kandidaten zur Weihe vor. Zuvor wird die Gemeinde des Kandidaten um eine Stellungnahme gebeten; auf welche Weise diese Stellungnahme eingeholt wird, regelt die diözesane Ordnung. Vor der Weihe erfolgt das Skrutinium durch den Bischof.
Da die Ehefrau des Kandidaten der Weihe zustimmen muss, ist zu gegebener Zeit ein Gespräch des (Erz-)Bischofs mit den Ehefrauen der Kandidaten sinnvoll.
4.2.5 Rechtzeitig
vor der Weihe erfolgt im Diakonatskreis eine theologische, liturgische und
geistliche Hinführung zum Weihesakrament. Die letzte innere Vorbereitung
geschieht durch die Teilnahme an den Weiheexerzitien.
4.3
Ausbildung, Berufseinführung und Fortbildung des Diakons mit Zivilberuf
Die Bildung des Diakons mit Zivilberuf gliedert sich in folgende Phasen: die Ausbildung, die Berufseinführung, die Fortbildung.
Die wesentlichen Elemente der Bildung sind die Förderung und Entfaltung der Spiritualität des Diakons, die Grundlegung, Vertiefung und fortlaufende Ergänzung des theologischen Wissens sowie die Vermittlung, Einübung und Weiterentwicklung pastoral-praktischer Befähigungen. In jeder Bildungsphase müssen sich Spiritualität, Theologie und pastoral-praktische Bildung gegenseitig ergänzen. Der Bildungsprozess insgesamt wie auch die einzelnen Elemente der Bildung müssen auf den spezifischen Dienst des Diakons angelegt sein und zugleich die mehrjährige ehrenamtliche Mitarbeit der Bewerber einbeziehen. Unbeschadet der Verantwortung der Bistümer und der Ausbildungsstätten für die Bildung der Diakone sind die ständige spirituelle und menschliche Formung sowie die theologische und pastoral-praktische Aus- und Fortbildung auch Aufgabe der Bewerber bzw. der Diakone selber.
4.3.1 Die Ausbildung zum Diakon mit Zivilberuf und die Berufseinführung finden berufsbegleitend statt.
Die theologische Ausbildung muss mindestens dem Grund- und Aufbaukurs von „Theologie im Fernkurs“, Würzburg, entsprechen. In eigenen Arbeitsgemeinschaften, nicht in den monatlichen Diakonatskreisen, werden die Lehrbriefe von „Theologie im Fernkurs“, Würzburg, vertieft und ergänzt. Erfolgreich abgeschlossene theologische Studien (Fachschule/Seminar, Fachhochschule, Hochschule, Universität) sind auf die theologische Ausbildung anzurechnen. Inwieweit andere theologische Studien angerechnet werden, entscheidet das Bistum. Ebenso entscheidet das Bistum, inwieweit Bewerber, die ihre Ausbildung nicht über die Lehrbriefe „Theologie im Fernkurs“, Würzburg, erhalten, an theologischen Arbeitsgemeinschaften teilnehmen müssen.
Die pastoral-praktische Einführung und Einweisung
in den Dienst des Diakons erfolgt in zusätzlichen Kursen und entsprechenden
Praktika. Die pastoral-praktische Ausbildung muss mindestens den Anforderungen
des pastoralen Spezialkurses im Studiengang „Pastorale Dienste“ von
„Theologie im Fernkurs“, Würzburg, entsprechen. Darüber hinaus ist eine
intensive homiletische Ausbildung erforderlich. Näheres regelt die
diözesane Ausbildungsordnung.
Die Einführung der Bewerber in die Praxis dient auch der Vorbereitung und Einübung auf Zusammenarbeit mit anderen hauptberuflichen und ehrenamtlichen Diensten; gleichzeitig soll die Gemeinde auf die Mitarbeit eines Diakons vorbereitet werden.
Der
erfolgreiche Abschluss der Ausbildung muss durch eine Prüfung nachgewiesen
werden. Näheres regelt die diözesane Prüfungsordnung.
Für die Ausbildung zum Diakon mit Zivilberuf gelten außerdem folgende Regelungen:
1. Die
Ausbildung ist inhaltlich so anzulegen, dass sie in etwa 4 Jahren abgeschlossen
werden kann.
2. Im Rahmen ihrer theologischen Bildung müssen künftige Diakone mit Zivilberuf mit mindestens befriedigendem Ergebnis den Grund- und Aufbaukurs von „Theologie im Fernkurs“, Würzburg, abgeschlossen haben. Interessenten/Bewerber mit den Voraussetzungen nach dem zweiten bzw. dritten Zugangsweg gem. Teil I, Ziff. 4.4.1 „Zugangswege zum hauptberuflichen Diakonat“ sind davon befreit.
Weitere Anforderungen legt die diözesane Ausbildungsordnung fest.
3. Die spirituelle Vertiefung, die Vergewisserung der Berufung und die persönliche Vorbereitung auf die Weihe sollen besonders gefördert werden.
4. Die theologische, pastoral-diakonische und spirituelle Ausbildung erfolgt auf diözesaner Ebene sowohl in den Diakonatskreisen wie in sonstigen Ausbildungsveranstaltungen. Zu diesen können die Kreise zusammengezogen werden.
5. Zur Ausbildung gehören auch Praktika im gemeindlichen und caritativen Bereich.
6. Die homiletische Ausbildung muss
- den sachgerechten Umgang mit Bibeltexten,
- eine Sensibilisierung für die Situation der Hörer und
- die methodische Befähigung für Vorbereitung und Gestaltung einer Predigt umfassen.
Der diakonischen und gesellschaftlichen Dimension der Predigt des Ständigen Diakons ist besondere Aufmerksamkeit zu widmen.
Nach einer theoretischen Grundlegung soll sich die praktische homiletische Ausbildung während des Gemeindepraktikums anschließen. Sie wird mit einer entsprechenden Prüfung abgeschlossen, die eine weitere Voraussetzung für die Weihe zum Ständigen Diakon ist.
Einzelheiten legen die (Erz-)Diözesen nach den pastoralen Erfordernissen fest.
7. Die Ausbildung zum Ständigen Diakon erfordert eine (erste) Dienstprüfung vor der Weihe.
Sie umfasst:
- den erforderlichen Abschluss des Grund-, Aufbau- und ggf. des religionspädagogischen Kurses von „Theologie im Fernkurs“, Würzburg,
- eine Predigtprüfung,
- ein Kolloquium zu Fragen der Pastoral und Liturgie,
- ggf. die Prüfung in weiteren Kursen von „Theologie im Fernkurs“, Würzburg, gem. diözesaner Regelung. (z. B. Religionspädagogik)
8. Mindestens die ersten zwei Jahre nach der Weihe dienen der Berufseinführung. Auf Teil II, § 11 (2) „Ernennung“ wird hingewiesen.
9. Studienbeihilfen bzw. Kostenübernahme werden durch die einzelne (Erz-)Diözese geregelt. Es soll jedoch innerhalb der bayerischen Diözesen möglichst einheitlich verfahren werden.
10. Weitere inhaltliche und organisatorische Einzelheiten regeln die (Erz-)Diözesen unter gegenseitiger Information selbst. Der Informationsaustausch erfolgt in der „Bayernkonferenz“.
4.3.2 Der Diakon mit Zivilberuf ist zur Fortbildung verpflichtet. Über seine Mitarbeit im Diakonenkreis hinaus muss er zur beruflichen Fortbildung und zur spirituellen Vertiefung an entsprechenden Kursen und Treffen teilnehmen.
Die Verpflichtung zur Fortbildung besteht bis zum Ende des 60. Lebensjahres. Der Diakon mit Zivilberuf hat an den vom Fachbereich/von der Arbeitsstelle festgelegten Fortbildungsveranstaltungen für die Ständigen Diakone teilzunehmen. Bei der Termingestaltung sind die familiären und beruflichen Belange der Diakone mit Zivilberuf zu berücksichtigen. Die Kosten der Fortbildung übernimmt die (Erz-)Diözese.
Will der Diakon mit Zivilberuf Fortbildungsveranstaltungen anderer kirchlicher Träger/Organisationen wahrnehmen, so wird hierfür ein Zuschuss zu den entstandenen Tagungskosten gem. diözesaner Fortbildungsordnung gewährt[6]. Voraussetzung ist, dass die Genehmigung zur Teilnahme vor der Anmeldung eingeholt worden ist.
Näheres regelt die diözesane Fortbildungsordnung.
4.4
Ausbildung, Berufseinführung und Fortbildung des hauptberuflichen
Diakons
Die Bildung des hauptberuflichen Diakons gliedert sich in drei Phasen: Ausbildung, Berufseinführung und Fortbildung.
Die wesentlichen Elemente der Bildung sind die Förderung und Entfaltung der Spiritualität des Diakons, die Grundlegung, Vertiefung und fortlaufende Ergänzung des theologischen Wissens sowie die Vermittlung, Einübung und Weiterentwicklung pastoral‑praktischer Befähigungen. In jeder Bildungsphase müssen sich Spiritualität, Theologie und pastoral-praktische Bildung gegenseitig ergänzen. Der Bildungsprozess insgesamt wie auch die einzelnen Elemente der Bildung müssen auf den spezifischen Dienst des Diakons angelegt sein. Unbeschadet der Verantwortung der Bistümer und der Ausbildungsstätten für die Bildung der Diakone sind die ständige spirituelle und menschliche Formung sowie die theologische und pastoral-praktische Aus- und Fortbildung auch Aufgabe der Bewerber bzw. der Diakone selber.
Die Ausbildung, Berufseinführung und Fortbildung sind für den hauptberuflichen Ständigen Diakonat gesondert zu konzipieren. Mit Rücksicht auf die praktische Zusammenarbeit sind, vornehmlich in der zweiten und dritten Bildungsphase, auch gemeinsame Bildungsveranstaltungen für Ständige Diakone mit anderen pastoralen Diensten vorzusehen.
Die erste und zweite Bildungsphase werden näherhin in der diözesanen Ausbildungsordnung für Ständige Diakone geregelt. Sie müssen differenziert für die verschiedenen Zugangswege angelegt sein.
Besonders hinsichtlich der Einführung in die liturgischen Dienste und in den Verkündigungsdienst muss der inhaltliche Anspruch der zweiten Bildungsphase mit der der Priester vergleichbar sein. Insgesamt darf der Anspruch der zweiten Bildungsphase nicht hinter dem Anspruch anderer pastoraler Dienste zurückbleiben.
Die Zeit der Berufseinführung (zweite Bildungsphase) ist gekennzeichnet durch Reflexion des pastoralen Dienstes und durch Supervision des individuellen Handelns des Ständigen Diakons (vgl. Teil II, § 11 (2).
Die dritte Bildungsphase schließt an die Berufseinführung an und umfasst die gesamte Zeit des hauptberuflichen Dienstes als Ständiger Diakon.
Für einen Ständigen Diakon mit Zivilberuf, der in den hauptberuflichen Dienst wechselt und seine zweite Bildungsphase (Berufseinführung) absolviert hat, beginnt die dritte Bildungsphase, wenn er die diözesanen Voraussetzungen für den hauptberuflichen Dienst erfüllt hat (vgl. Teil II, § 6).
4.4.1 Zum hauptberuflichen Diakonat gibt es drei Zugangswege:
Der erste Zugangsweg ist eine erfolgreich abgeschlossene berufs- oder praxisbegleitende theologische Ausbildung, die mindestens einer Fachschulausbildung entspricht, ergänzt durch eine entsprechende pastoral-praktische Ausbildung und Praxis. Dieser Zugangsweg kommt insbesondere für Diakone mit Zivilberuf in Frage. Diakonatsbewerber, die eine Ausbildung für Sozial- oder Religionspädagogik an einer Fachhochschule oder eine Ausbildung für soziale oder katechetische Berufe in einer Fachschule abgeschlossen haben, nehmen ebenfalls an dieser praxisbegleitenden Ausbildung teil. Bei diesem Zugangsweg greifen Ausbildung und Berufseinführung inhaltlich und zeitlich ineinander.
Teil I, Ziff. 4.3.1 „Ausbildung zum Diakon mit Zivilberuf“ gilt mit folgenden Ergänzungen bzw. Änderungen:
1. Für den Zugang zum hauptberuflichen Dienst ist von Bewerbern um den Ständigen Diakonat und von Diakonen mit Zivilberuf, die die Voraussetzungen des ersten Zugangsweges erfüllen, eine Zusatzausbildung zu absolvieren:
Möglichkeiten dazu bieten:
- der religionspädagogische Kurs von „Theologie im Fernkurs“, Würzburg (vgl. Teil II, § 13 (2)),
- der Pastoralkurs an der Katholischen Stiftungsfachhochschule/Philosophisch-Theologischen Hochschule in Benediktbeuern.
Die Vergütung während der Teilnahme an diesem Kurs richtet sich nach den Bestimmungen des Teils II, § 24. Die Kosten für die zusätzliche Ausbildung übernimmt die (Erz-) Diözese.
Dadurch erhöht sich die Gesamtdauer der Ausbildung auf 5 ‑ 6 Jahre.
2. Diakone mit Zivilberuf bleiben bis zum erfolgreichen Abschluss der zusätzlichen Ausbildung Diakone mit Zivilberuf.
3. Die Möglichkeit zu einer zweiten Dienstprüfung kann nach der Berufseinführung wahrgenommen werden und ist Voraussetzung für einen Bewährungsaufstieg; sie umfasst mindestens:
- die Vorbereitung und Reflexion eines pastoralen Projektes,
- eine Einzelaufgabe aus der pastoralen Praxis,
- ein Kolloquium zu Fragen der Pastoral und Liturgie,
- eine Predigtprüfung.
Die zweite Dienstprüfung kann in der Regel bis zur Vollendung des 54. Lebensjahres abgelegt werden.
Weitere Einzelheiten zu den Dienstprüfungen werden in einer diözesanen Prüfungsordnung festgelegt.
4. Während der zusätzlichen Ausbildung sind auch gemeinsame Ausbildungseinheiten mit den anderen pastoralen Berufen wegen der später notwendigen Kooperation vorzusehen.
Der zweite Zugangsweg setzt die abgeschlossene Berufsausbildung (Zweite Dienstprüfung) als Gemeindereferent oder Pastoralreferent voraus. Sie wird ergänzt durch Hinführung zum Leben und Dienst des Diakons durch eine mindestens zweijährige Teilnahme am Diakonatskreis.
Bei Bewerbern aus diesen Berufen können die Ausbildungsanforderungen beschränkt sowie die Gesamtzeit der Ausbildung verkürzt werden (vgl. auch Teil I Ziff. 3.3 „Fachliche Voraussetzungen“).
Der dritte Zugangsweg setzt ein abgeschlossenes theologisches Studium voraus (Diplom bzw. theologisches Staatsexamen mit theologischer Zusatzausbildung, ergänzt durch eine entsprechende pastoral-praktische Ausbildung und Praxis; Abschlussprüfung an einer Fachhochschule im Fachbereich Theologie/Praktische Theologie/Religionspädagogik oder an einer Fachschule/Seminar für Gemeindepastoral/Religionspädagogik, jeweils ergänzt durch eine entsprechende pastoralpraktische Ausbildung und Praxis). Die Berufseinführung für den Dienst des Diakons erfolgt im Rahmen einer mindestens dreijährigen Teilnahme am Diakonatskreis.
Für alle drei Zugangswege zum hauptberuflichen Diakonat werden die Phasen der Ausbildung und Berufseinführung mit einer kirchlichen Prüfung abgeschlossen. Näheres regelt die diözesane Ausbildungs- und Prüfungsordnung.
Für den zweiten und dritten Zugangsweg zum hauptberuflichen Ständigen Diakon bedarf es neben den genannten Voraussetzungen einer mehrjährigen Tätigkeit in der Gemeindepastoral.
Wenn die betreffenden, aus einem anderen pastoralen Beruf kommenden Interessenten/Bewerber/ Kandidaten eine zweite Dienstprüfung abgelegt haben, wird diese anerkannt.
Inwieweit eine zweite Dienstprüfung grundsätzlich Voraussetzung für eine Übernahme in den hauptberuflichen Dienst ist, bestimmt die diözesane Ordnung.
4.4.2 Der hauptberufliche Diakon bleibt zur Fortbildung verpflichtet.
Über seine Mitarbeit im Diakonenkreis hinaus muss er zur beruflichen
Fortbildung und zur spirituellen Vertiefung an entsprechenden Kursen und Treffen
teilnehmen. Näheres regelt die diözesane Fortbildungsordnung.
1. Der Diakon im Hauptberuf unterliegt den gleichen Regelungen für die Fortbildung wie die Diakone mit Zivilberuf (vgl. Teil I, Ziff. 4.3.2). Zusätzliche verpflichtende Fortbildungsveranstaltungen können durch die (Erz-)Diözese angeordnet werden.
2. Dem Diakon im Hauptberuf stehen im Jahr fünf Tage zur freiwilligen, genehmigten beruflichen Fortbildung zu.
3. Der Diakon ist zur regelmäßigen Teilnahme an Exerzitien verpflichtet (vgl. auch Teil II, § 17 (2)).
4. Weitere Einzelheiten regeln die bayerischen (Erz-)Diözesen selbst, informieren sich aber regelmäßig über grundsätzliche diözesane Entscheidungen. Das Forum hierfür ist die „Bayernkonferenz“
Teil II - Dienstrechtliche Bestimmungen
1. Dienstrechtliche Grundlagen
§ 1
Rechtsnatur des kirchlichen Dienstverhältnisses
(1) Das Dienstverhältnis des Ständigen Diakons ist gem. cc. 1008f CIC ein Klerikerdienstverhältnis. Durch die Inkardination, die mit der Diakonenweihe erfolgt, untersteht der Ständige Diakon als Kleriker dem Diözesanbischof als Inkardinationsordinarius. Der Bischof hat seinerseits die einem Kleriker im Rahmen des kirchlichen Rechts (vgl. can. 281 CIC) zustehenden Rechte zu sichern, die seine dienstliche Verwendung betreffen, sowie die geistliche Begleitung und einen angemessenen Lebensunterhalt des Diakons und seiner Familie zu gewährleisten.
(2) Der Ständige Diakon mit Zivilberuf sorgt gem. can. 281 § 3 CIC mit seinen Einkünften und Anwartschaften aus seinem Zivilberuf für sich und die Erfordernisse seiner Familie.
(3) Der Ständige Diakon stellt sich der Ortskirche von Augsburg unwiderruflich zur Verfügung und steht auf Grund der Inkardination in einem besonderen und wechselseitigen Treueverhältnis zum Diözesanbischof[7]. Der Generalvikar ist übergeordneter Dienstvorgesetzter des Ständigen Diakons. Der unmittelbare Dienstvorgesetzte des Ständigen Diakons, ggf. auch sein Fachvorgesetzter, wird im Anweisungs- oder Versetzungsdekret durch den Ordinarius bestimmt.
§ 2
Anzuwendende Vorschriften
Die dienstrechtliche Stellung des Ständigen Diakons, die in der Einheit von sakramentaler Befähigung und ekklesialer Sendung gründet, bestimmt sich nach den Vorschriften des Codex Iuris Canonici und den Bestimmungen dieser Dienst- und Vergütungsordnung.
„Die Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse“ findet keine Anwendung (vgl. Heft 51, hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn, 1993).
§ 3
Beginn und Gestalt des kirchlichen Dienstverhältnisses
(1) Das Dienstverhältnis des Ständigen Diakons beginnt mit der Diakonenweihe. Durch die Weihe erfolgt gemäß can. 266 § 1 CIC die Aufnahme des Ständigen Diakons in den Klerikerstand sowie die Inkardination in die Teilkirche, für deren Dienst er geweiht worden ist.
(2) Der Ständige Diakon ist entweder hauptberuflich oder nebenberuflich (mit einem Zivilberuf) tätig. Hauptberuflicher Ständiger Diakon ist, wer von seinem (Erz-)Bischof als hauptberuflicher Diakon in Dienst genommen ist.
(3) Es wird unterschieden zwischen dem
-
Diakon im Hauptberuf
(DHb)
-
hauptberuflicher Diakon im Ruhestand
(DHbiR)
-
Diakon mit Zivilberuf
(DmZ)
-
Diakon mit zivilberuflichem Ruhestand
(DmZiR)
-
entpflichteter Diakon
(Dentpfl)
§ 4
Tätigkeitsform des Diakons im Hauptberuf
(1) Der hauptberufliche Ständige Diakon wird entsprechend dem Klerikerdienstrecht des Codex Iuris Canonici und den sonstigen kirchenrechtlichen Regelungen eingesetzt.
(2) Der Ständige Diakon im Hauptberuf wird eingesetzt:
- im pfarrlichen Dienst
- in der kategorialen Seelsorge
- in der Erteilung des Religionsunterrichts
- im besonderen Auftrag.
In einem Anweisungsdekret (vgl. § 11 Abs. 1) werden der Einsatz und die Aufgaben festgelegt. Ein Wechsel zwischen den Tätigkeiten der genannten Bereiche hauptberuflichen Dienstes kann nur erfolgen, wenn die diözesanen, insbesondere die ausbildungsmäßigen Voraussetzungen erfüllt sind.
(3) Ein Ständiger Diakon, der nicht hauptberuflich im pfarrlichen Dienst eingesetzt ist, wird einer Pfarrei zugeordnet. Soweit es mit seiner Haupttätigkeit vereinbar ist, soll er Aufgaben in dieser Pfarrei übernehmen.
(4) Wer einen anderen pastoralen oder religionspädagogischen Beruf im Dienst seiner (Erz-)Diözese ausgeübt hat, wird mit der Diakonenweihe Ständiger Diakon im Hauptberuf. Der bisherige Tätigkeitsbereich ist dabei auf den diakonischen Dienst hin zu überprüfen. Das bisherige Arbeitsverhältnis im kirchlichen Dienst endet mit der Weihe; es ist zeitgerecht und einvernehmlich aufzulösen.
(5) Ein Zugang zum Diakon im Hauptberuf ohne vorherige Tätigkeit als Diakon mit Zivilberuf richtet sich nach den diözesanen Regelungen.
§ 5
Tätigkeitsform des Diakons mit Zivilberuf
(1) Nebenberuflich wird als Ständiger Diakon eingesetzt, wer hauptberuflich einen Zivilberuf ausübt oder ausgeübt hat und aus seinem Zivilberuf Besoldung, Vergütung oder Versorgung bezieht.
(2) Der Ständige Diakon mit Zivilberuf wird in der Regel in der Gemeindepastoral und zwar vorwiegend an seinem Wohnort eingesetzt. Davon unberührt bleibt, dass ihm in besonderer Weise aufgegeben ist, „in der zivilberuflichen Welt die Diaconia Christi durch Leben und Wort zu bezeugen“ (vgl. Teil I, Ziff. 2).
(3) Die Tätigkeit des Diakons mit Zivilberuf wird durch eine monatliche Pauschale[8] vergolten. Entstandene Auslagen werden dem Ständigen Diakon mit Zivilberuf gemäß diözesaner Regelung ersetzt.
§ 6
Änderung der Tätigkeitsformen
(1) Die gemäß §§ 4 und 5 festgelegte Tätigkeitsform kann auf Antrag geändert werden, und zwar sowohl vom hauptberuflichen Diakon zum Diakon mit Zivilberuf als auch vom Diakon mit Zivilberuf zum hauptberuflichen Diakon.
(2) Maßgebend für die Entscheidung über die Änderung der Tätigkeitsform sind einerseits die pastoralen Erfordernisse und die Möglichkeiten der (Erz-)Diözese, andererseits die Voraussetzungen und Fähigkeiten auf Seiten des Ständigen Diakons.
Der eine hauptberufliche Tätigkeitsform anstrebende Diakon mit Zivilberuf muss über eine zusätzliche Qualifikation gemäß diözesaner Regelung verfügen oder sie erwerben; ein Wechsel in den hauptberuflichen Dienst ist in der Regel erst nach einer angemessenen Zeit als Diakon mit Zivilberuf möglich, wobei von einem Zeitraum von wenigstens zwei Jahren ausgegangen wird.
(3) Eine Änderung der Tätigkeitsform soll im Einvernehmen mit dem Ständigen Diakon erfolgen. Ein Anspruch auf die Übernahme in den hauptberuflichen Dienst als Ständiger Diakon besteht auch bei Erfüllung der diözesanen Voraussetzungen nicht.
§ 7
Unvereinbarkeit von Tätigkeiten, Nebentätigkeiten
(1) Dem hauptberuflichen Ständigen Diakon sind alle Tätigkeiten in gleicher Weise untersagt, die gemäß cc. 285‑287 CIC (vgl. auch can. 289 CIC) von Priestern nicht ausgeübt werden dürfen. Jede Nebentätigkeit bedarf der Genehmigung des Diözesanbischofs. Die Wahrnehmung eines politischen Mandats, einer Leitungsaufgabe bei Tarifparteien, der Rechte und Pflichten eines Testamentsvollstreckers oder eines gerichtlich bestellten Betreuers sind dem Ständigen Diakon nur im Einvernehmen mit dem Bischof möglich.
(2) Unvereinbar mit dem Dienst eines Ständigen Diakons mit Zivilberuf sind alle Tätigkeiten, Berufe, Aufgaben, Dienste und Funktionen, die nach dem Urteil des Diözesanbischofs dem Ansehen des geistlichen Dienstes oder dem pastoralen Wirken des Ständigen Diakons abträglich sind oder bei denen die Gefahr einer unzulässigen Interessenkollision besteht.
(3) Mit dem Dienst eines Ständigen Diakons sind grundsätzlich Tätigkeiten unvereinbar, deren zeitliche bzw. physische oder psychische Beanspruchung seine vorgesehene Seelsorgsarbeit behindern.
Hauptberufliche Mesner-/Küstertätigkeit und Ständiger Diakonat schließen sich aus.
(4) Jede beabsichtigte Änderung der
zivilberuflichen Tätigkeit ist dem Diözesanbischof vor Vertragsabschluss vom
Ständigen Diakon anzuzeigen. Entsprechendes gilt, wenn sich ein Diakon mit
Zivilberuf selbständig machen will.
§ 8
Ruhestand, Entpflichtung
(1) Der Diakon im Hauptberuf beendet mit Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze seine hauptberufliche Tätigkeit und tritt in den Ruhestand.
Er kann mit Zustimmung der (Erz-)Diözese und bei pastoraler Notwendigkeit längstens bis zum Erreichen der für Priester in der jeweiligen (Erz-)Diözese geltenden Altersgrenze eingesetzt werden. In diesem Fall erhält er als Aufzahlung den Differenzbetrag zwischen seiner letzten Bruttovergütung und seinen Versorgungsbezügen. Mit Erreichen der Altersgrenze für Priester wird der Ständige Diakon von seinen Aufgaben entpflichtet.
(2) Kann bzw. darf ein hauptberuflicher Ständiger Diakon vor Erreichen der vorgesehenen Altersgrenze aus persönlichen Gründen seinen Dienst nicht mehr ausüben[9], erhält er eine Hilfe, die in Netto der Höhe der Erwerbsunfähigkeitsrente bzw. der Arbeitslosenhilfe entspricht, die ihm zu diesem Zeitpunkt zustehen würde. Diese Hilfe wird gewährt, sofern und solange er aus anderen persönlichen oder familiären Einkünften den Lebensunterhalt für sich und seine Familie nicht bestreiten kann.
(3) Einem Diakon mit Zivilberuf können nach Erreichen der Altersgrenze in seinem Zivilberuf zeitlich befristet Tätigkeitsform und Aufgaben unter Fortgewährung der monatlichen Pauschale gemäß § 5 Abs. 3 zugewiesen werden. Mit Erreichen der Altersgrenze für Priester wird der Ständige Diakon von seinen Aufgaben entpflichtet.
(4) Kann ein Diakon mit Zivilberuf aus persönlichen oder pastoralen Gründen den Dienst eines Diakons auf Dauer nicht mehr ausüben, wird er entpflichtet.
§ 9
Wechsel des kirchlichen Dienstverhältnisses
(1) Das Dienstverhältnis eines Ständigen Diakons kann gemäß cc. 267‑270 CIC durch Umkardination in eine andere Inkardinationsdiözese geändert werden.
(2) Die Inkardination eines Diakons mit Zivilberuf wird durch einen Wohnsitzwechsel in eine andere Diözese nicht berührt. Die Ausübung des Dienstes als Diakon außerhalb der Inkardinationsdiözese ist so lange nicht zulässig, bis in sinngemäßer Anwendung von can. 271 CIC eine Regelung mit dem Diözesanbischof der neuen Wohnsitzdiözese vereinbart oder eine Umkardination durchgeführt ist. Der Diakon mit Zivilberuf teilt seinem Inkardinationsordinarius den beabsichtigten Wohnsitzwechsel rechtzeitig mit und setzt den Diözesanbischof der neuen Wohnsitzdiözese davon in Kenntnis. Der Inkardinationsordinarius informiert seinerseits den Diözesanbischof des neuen Wohnsitzes des Diakons mit Zivilberuf. Beide Diözesanbischöfe vereinbaren unter Mitwirkung des betroffenen Diakons eine vertragliche Regelung über den Dienst des Diakons mit Zivilberuf. Der Diözesanbischof der neuen Wohnsitzdiözese ist nicht gehalten, dem Diakon mit Zivilberuf die Ausübung des Dienstes im gleichen Umfang wie in der Inkardinationsdiözese zu ermöglichen.
(3) Der Ständige Diakon ist stets an die Weisungen des jeweiligen Diözesanbischofs gebunden und darf ohne seine Erlaubnis keinen seelsorgerlichen Dienst ausüben.
§ 10
Beendigung des kirchlichen Dienstverhältnisses
(1) Das Dienstverhältnis eines Ständigen Diakons endet mit dem Verlust des Klerikerstandes gemäß can. 290 CIC.
(2) Der Ständige Diakon verliert gemäß can. 290 CIC den Klerikerstand durch kirchenamtliche Feststellung der Ungültigkeit der empfangenen Diakonenweihe, durch die rechtmäßig verhängte Strafe der Entlassung aus dem Klerikerstand oder durch Reskript des Apostolischen Stuhls.
(3) Im Falle einer Suspendierung wird der Umfang der untersagten Tätigkeiten festgelegt (vgl. can. 1333 CIC).
(4) Bei Verlust des Klerikerstandes oder bei einer gänzlichen Suspendierung soll mit Ausnahme der in can. 290 n. 2 CIC vorgesehenen Fälle eine Beschäftigung in kirchlichen Einrichtungen nach Maßgabe der gegebenen Umstände angestrebt und ein Arbeitsverhältnis begründet werden.
2. Dienstrechtliche Einzelbestimmungen
§ 11
Ernennung
(1) Dem Ständigen Diakon wird durch ein schriftliches Ernennungsdekret des Diözesanbischofs eine Stelle übertragen oder durch eine Anweisung ein Aufgabenbereich in einem bestimmten Einsatzgebiet zugewiesen. In einem Ernennungsdekret bzw. einer Anweisung sind Tätigkeitsform und Aufgabe des Diakons anzugeben; ferner werden der unmittelbare kirchliche Vorgesetzte und der Dienstort benannt. Das erste Ernennungsdekret bzw. die erste Anweisung werden dem Ständigen Diakon regelmäßig mit der Weiheurkunde ausgehändigt.
(2) Wenigstens die ersten zwei Dienstjahre gelten als Berufseinführung; hierbei kann eine in einem anderen pastoralen Beruf erfolgte Berufseinführung angerechnet werden. Während dieser Zeit wird dem Ständigen Diakon ein Mentor, und zwar ein Ständiger Diakon oder Priester, zur Seite gestellt (vgl. auch Teil I, 4.3.1 und 4.4).
(3) Bei einem Diakon mit Zivilberuf sind für die Auswahl der Stelle und der zu übertragenden Aufgaben seine berufliche Tätigkeit und seine zusätzliche Belastbarkeit zu berücksichtigen. Der zukünftige Aufgabenbereich soll bereits vor der Diakonenweihe im Einvernehmen mit dem Weihekandidaten und dem zukünftigen kirchlichen Vorgesetzten geklärt werden.
§ 12
Versetzung
(1) Der hauptberufliche Ständige Diakon und der Diakon mit Zivilberuf können versetzt werden. Eine Versetzung ist sowohl aus pastoralen Erfordernissen als auch aus personbezogenen Gründen möglich. Vor einer Versetzung ist der Ständige Diakon zu hören. Freie oder freiwerdende Stellen für Ständige Diakone werden in der Regel ausgeschrieben. Bei Versetzungen ist ferner der Diözesansprecher des Sprecherrates (vgl. § 21) zu hören.
(2) Eine Versetzung kann auch auf Wunsch des Ständigen Diakons erfolgen. Der Versetzungswunsch ist dem Diözesanbischof rechtzeitig vorzutragen.
(3) Bei einer Versetzung sind die persönlichen oder familiären Verhältnisse des Ständigen Diakons zu berücksichtigen. Bei der Versetzung eines Diakons mit Zivilberuf wird aufgrund eines zivilberuflich bedingten Wohnsitzwechsels innerhalb der Inkardinationsdiözese wegen pastoraler Erfordernisse der bisherige Aufgabenkreis verändert werden.
(4) Das schriftliche Versetzungsdekret enthält die gleichen Angaben wie ein Ernennungsdekret.
(5) Versetzungen und Entpflichtungen werden vom Diözesanbischof ausgesprochen (vgl. auch Teil II, §§ 8 und 11).
§ 13
Aufgabenumschreibung
(1) Zusammen mit einem Ernennungs- oder Versetzungsdekret ist eine Aufgabenumschreibung gemäß den drei Grunddiensten (Verkündigung des Gotteswortes, Heiligung der Gläubigen und Diakonie) zu erstellen.
(2) Der hauptberufliche Ständige Diakon im pfarrlichen Dienst soll 6-8 Wochenstunden Religionsunterricht an öffentlichen Volksschulen erteilen. Bei der Beauftragung zum Religionsunterricht werden das Alter des Diakons und sein Gesundheitszustand berücksichtigt.
(3) Aufgrund pastoraler Notwendigkeiten kann eine Neuumschreibung des Aufgabenbereichs erforderlich werden. Dabei werden nach Anhörung des Diakons für die Entscheidung erhebliche persönliche Umstände und Fähigkeiten nach Möglichkeit berücksichtigt.
§ 14
Amtseinführung
Der Ständige Diakon wird in seinen Aufgabenbereich durch den unmittelbaren kirchlichen Vorgesetzten in geeigneter Weise eingeführt; der Ständige Diakon im pfarrlichen Dienst bei den sonntäglichen Gemeindegottesdiensten.
§ 15
Residenzpflicht, Dienstwohnung, Dienstzimmer
(1) Der Ständige Diakon im pfarrlichen Dienst soll an seinem Dienstort oder einem seiner Dienstorte wohnen. Bei der Wohnungssuche ist die (Erz-)Diözese behilflich.
(2) Dem hauptberuflichen Ständigen Diakon können Wohnort und Dienstwohnung zugewiesen werden.
(3) Dem hauptberuflichen Ständigen Diakon im pfarrlichen Dienst soll ein Dienstzimmer wenigstens zur Mitbenutzung zur Verfügung stehen. Gleiches gilt auch bei einem Einsatz im kategorialen Bereich. Der Arbeitsplatz soll den pastoralen Erfordernissen angemessen sein.
Ist dies nicht möglich, so soll dem Diakon im Hauptberuf anderweitig mit Zustimmung des (Erz-) Bischöflichen Ordinariates an seinem Dienstort ein solcher Arbeitsplatz eingerichtet werden.
Die laufenden Kosten (Büroraum und -betrieb) werden von der jeweiligen Kirchenstiftung, diözesanen Dienststelle oder Einrichtung übernommen.
(4) Für Dienstfahrten gelten die einschlägigen diözesanen Regelungen.
(5) Die liturgische Kleidung für den Ständigen Diakon stellt die Kirchenstiftung, diözesane Dienststelle oder Einrichtung zur Verfügung.
§ 16
Zeitliche Gestaltung des Dienstes
(1) Die konkrete zeitliche Gestaltung des Dienstes ist im Benehmen mit dem Ständigen Diakon und den anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im pastoralen Dienst vom unmittelbaren kirchlichen Vorgesetzten festzulegen[10]. Einzubeziehen sind dabei sowohl anfallende pastorale Notwendigkeiten als auch angemessene Zeit für Gebet, Betrachtung, Studium und Sorge um die Mitbrüder. Die Rechte der Ehefrau und der Kinder bei verheirateten Diakonen müssen bei der konkreten Festlegung des Dienstes gebührend berücksichtigt werden. Da der Eigencharakter des geistlichen Dienstes ein hohes Maß an Disponibilität und Flexibilität verlangt, ist es weder angebracht noch möglich, den vorgesehenen Dienst in seinem vollen Umfang zeitlich festzulegen. Vielmehr gilt als Regel, dass etwa die Hälfte des Dienstes zeitlich festgelegt werden soll. Die übrige Zeit richtet sich nach den pastoralen Erfordernissen, wobei der Dienst im Pfarrbüro, soweit erforderlich, nicht mehr als ein Viertel des gesamten Dienstes betragen soll.
(2) Für den Diakon mit Zivilberuf lässt sich die zeitliche Gestaltung des Dienstes mit Rücksicht auf seinen Zivilberuf nicht genauer bestimmen, soll aber in Absprache mit dem unmittelbaren kirchlichen Vorgesetzten sechs Wochenstunden nicht unterschreiten; jedoch darf sich seine Tätigkeit nicht in der Assistenz beim Gottesdienst erschöpfen. Die Absprache zwischen dem künftigen unmittelbaren Dienstvorgesetzten und dem Diakon mit Zivilberuf über den inhaltlichen und zeitlichen Umfang seiner Tätigkeit hat vor Erstellung der Anweisung zu erfolgen (Teil II § 11 Abs. 3 Satz 3) und ist in geeigneter Weise der Pfarrgemeinde sowie den gewählten ortskirchlichen Gremien bekanntzugeben.
(3) Dem hauptberuflichen Ständigen Diakon steht ein voller dienstfreier Tag in der Woche zu. Die dienstfreien Tage werden unter Berücksichtigung der pastoralen Erfordernisse im Benehmen mit dem Diakon vom unmittelbaren kirchlichen Vorgesetzten festgelegt, wobei auch Sonn- und Feiertage aus familiären Gründen in vertretbarem Maße berücksichtigt werden sollen; monatlich sollen zusammenhängend ein Samstag und Sonntag von dienstlichen Verpflichtungen frei sein.
(4) Der hauptberufliche Ständige Diakon im Ruhestand gestaltet seine dienstliche Anwesenheit nach Maßgabe von Teil II § 8 Abs. 1 im Einvernehmen mit dem unmittelbaren Dienstvorgesetzten. Die Regelung in Satz 1 findet auf Ständige Diakone mit Zivilberuf im Ruhestand sinngemäße Anwendung.
§ 17
Fortbildung
(1) Der Ständige Diakon ist zu spiritueller Vertiefung und beruflicher Fortbildung verpflichtet. Näheres regelt die diözesane Fortbildungsordnung.
(2) Die Zeit für die Teilnahme an Exerzitien oder geistlichen Einkehrtagen gemäß can. 276 § 2 n. 4 CIC und an Fortbildungsveranstaltungen gemäß den diözesanen Vorschriften gilt als Dienst.
Die Teilnahme an Exerzitien ist alle drei Jahre verpflichtend[11].
(3) Für den Diakon mit Zivilberuf sollen Fortbildungsmöglichkeiten geschaffen werden, an denen er unter Berücksichtigung seiner beruflichen und familiären Situation teilnehmen kann. Dafür sollten grundsätzlich nicht mehr als fünf Urlaubstage eingesetzt werden. Näheres regelt die diözesane Fortbildungsordnung[12].
§ 18
Urlaub, Dienstbefreiung
(1) Dem hauptberuflichen Ständigen Diakon steht ein jährlicher Urlaub zu. Näheres ist in Anlage 2 Abs. 1 geregelt.
Urlaub ist vom hauptberuflichen Ständigen Diakon in Absprache mit seinem unmittelbaren Dienstvorgesetzten im (Erz-)Bischöflichen Ordinariat zu beantragen.
(2) Dienstbefreiungen werden auf Antrag durch das (Erz-)Bischöfliche Ordinariat gem. Anlage 2 Abs. 3 gewährt.
(3) Bei Dienstunfähigkeit ist der unmittelbare Dienstvorgesetzte unverzüglich zu verständigen. Dem (Erz-)Bischöflichen Ordinariat ist nach drei Tagen eine ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorzulegen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als in der Bescheinigung angegeben, ist eine neue vorzulegen, aus der ggf. die voraussichtliche Dauer der Dienstunfähigkeit hervorgeht.
(4) Das (Erz-)Bischöfliche
Ordinariat kann bei gegebenem Anlass durch einen Arzt des Vertrauens feststellen
lassen, ob der Ständige Diakon dienstfähig oder frei von ansteckenden
Krankheiten ist.
(5) Für Diakone mit Zivilberuf richtet sich die Zeit der Abwesenheit von ihrem Aufgabenbereich als Diakon nach der aus dem Zivilberuf zustehenden Urlaubszeit; der unmittelbare kirchliche Vorgesetzte ist rechtzeitig zu informieren.
§ 19
Zusammenarbeit
(1) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kirchlichen Dienst sind bei aller notwendigen Arbeitsteilung auf Zusammenarbeit im konkreten Einsatzbereich verwiesen und angewiesen.
(2) Der Ständige Diakon im pfarrlichen Dienst ist unbeschadet seiner besonderen Verantwortung für die ihm übertragenen Aufgaben zur Zusammenarbeit mit allen anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im pastoralen Dienst des Einsatzgebietes verpflichtet.
(3) Für einen in einer Pfarrei ohne eigenen Pfarrer[13] tätigen Ständigen Diakon sind die Weisungen des priesterlichen Leiters der Seelsorge maßgebend; gleichzeitig ist er zur Zusammenarbeit mit anderen vom (Erz-)Bischof[14] bzw. mit anderen vom Pfarrer/priesterlichen Leiter[15] mit Leitungsaufgaben Beauftragten verpflichtet.
(4) Die Aufgabenverteilung im konkreten Einsatzgebiet zwischen Priestern, Ständigen Diakonen und sonstigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im pastoralen Dienst innerhalb desselben Einsatzgebietes erfolgt unter Berücksichtigung der mit der sakramentalen Weihe übertragenen Befugnisse, der festgelegten Aufgabenbereiche sowie des maßgeblichen Pastoralkonzeptes nach Absprache mit den Betroffenen durch den unmittelbaren kirchlichen Vorgesetzten des Ständigen Diakons.
Ständige Diakone sind geborene Mitglieder des Pfarrgemeinderates. Sind mehrere Diakone in einer Pfarrei angewiesen, ist einer von ihnen durch den Pfarrer/priesterlichen Leiter nach Absprache mit den Ständigen Diakonen als dauernder Vertreter zu bestimmen.
(5) An den Dienstbesprechungen der im pastoralen Dienst der Pfarrei Tätigen nimmt der Ständige Diakon im pfarrlichen Dienst teil. Dienstbesprechungen sollen alle zwei Monate zeitlich so gelegt werden, dass auch ein Diakon mit Zivilberuf außerhalb seiner zivilberuflichen Arbeit teilnehmen kann. Darüber hinaus soll eine kontinuierliche und umfassende Information seitens des unmittelbaren kirchlichen Vorgesetzten erfolgen.
(6) Der Ständige Diakon soll auch über
sein Einsatzgebiet hinaus Bereitschaft zur Kooperation zeigen. Er soll -
entsprechend seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten - Mit- und Aushilfen in
anderen Pfarreien oder in anderen, auch in überpfarrlichen Bereichen übernehmen,
soweit dies mit seiner konkreten Aufgabenzuweisung vereinbar ist. Sie sind
wenigstens einmal jährlich mit dem unmittelbaren Dienstvorgesetzten zu
besprechen.
§ 20
Gemeinschaft mit Priestern und anderen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im pastoralen Dienst
Priester, Ständige Diakone sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im pastoralen Dienst sollen bestrebt sein, eine angemessene Form gemeinschaftlichen Lebens zu finden und zu praktizieren. Dies soll sich nicht nur auf dienstliche Belange beschränken, sondern auch Gebet und persönliche Kontakte umfassen.
§ 21
Diakonenkreis, Standesvereinigung
(1) Der Ständige Diakon soll an den Zusammenkünften eines in der Diözese errichteten Diakonenkreises teilnehmen und zum Leben dieses Kreises beitragen. Es werden regional Diakonatskreise für die Interessenten/Bewerber/Kandidaten sowie regionale Diakonenkreise für die Diakone gebildet[16].
(2) Der Ständige Diakon hat das Recht, sich mit anderen Diakonen bzw. sich mit allen Geistlichen der (Erz-)Diözese gemäß can. 278 § 1 CIC zusammenzuschließen.
(3) Die Ständigen Diakone einer (Erz-)Diözese wählen einen Sprecherrat. In ihm sind diejenigen im Hauptberuf, mit Zivilberuf und im Ruhestand, ggf. auch Delegierte der regionalen Diakonenkreise der (Erz-) Diözese, angemessen vertreten. Die Ehefrauen der Ständigen Diakone wählen zwei Vertreterinnen aus ihrem Kreis; sie gelten als Ansprechpartnerinnen und können zu Sitzungen des Sprecherrates eingeladen werden.
Der Diözesansprecher und sein Vertreter werden entweder aus dem Sprecherrat und von ihm oder aus und von allen Ständigen Diakonen gewählt; im letzteren Fall sind beide Mitglieder des Sprecherrates. Die Übernahme der Aufgabe als Diözesansprecher wird bei der zeitlichen Festlegung des Dienstumfanges angemessen berücksichtigt (vgl. Teil I, Ziff. 4., Abschn. 2.).
Der Bischöfliche Beauftragte und der Arbeitsstellen-/Fachbereichsleiter können zu den Sitzungen des Sprecherrates eingeladen werden. Sie haben beratende Funktion.
Der Sprecherrat arbeitet beratend an der Entwicklung des Ständigen Diakonates in der (Erz-)Diözese mit. Er vertritt die Belange der Diakone und ihrer Familien gegenüber den Verantwortlichen für den Ständigen Diakonat und repräsentiert die Diakone gegenüber den anderen kirchlichen Berufen und der Öffentlichkeit.
§ 22
Beschwerden, Konfliktlösung
(1) Meinungsverschiedenheiten sollen ohne Beeinträchtigung der Gerechtigkeit möglichst bald beigelegt werden. Entsprechend der Vorschrift des can. 1733 § 1 CIC ist ein Rechtsstreit zu vermeiden und durch gemeinsame Überlegung für eine billige Lösung Sorge zu tragen; dabei sollen gegebenenfalls auch angesehene Persönlichkeiten, die genaue Kenntnis der Sache erlangen können, zur Vermittlung beigezogen werden, so dass auf geeignete Weise Streit vermieden oder geschlichtet werden kann.
(2) Beschwerden über einen Ständigen Diakon, die dienstrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen können, sind dem Betroffenen zur Kenntnis zu bringen. Bevor andere dazu gehört werden, ist dem Betroffenen Möglichkeit zur Stellungnahme zu geben; er hat sich schriftlich zu äußern, ob er Stellung nehmen wird. Wird eine Beschwerde zu den Akten genommen, müssen auch alle Äußerungen oder Stellungnahmen des betroffenen Ständigen Diakons beigefügt werden.
(3) Der Ständige Diakon hat nach Maßgabe der kirchlichen Vorschriften das Recht auf Einsicht in seine Personalakten[17].
(4) Im dienstrechtlichen Konfliktfall suchen der Ständige Diakon und sein Vorgesetzter gemäß Abs. 1 eine Lösung.
Führt dieses Vorgehen nicht zu einer Lösung, wenden sich die Beteiligten an das (Erz-)Bischöfliche Ordinariat. Führt auch die Vermittlung des Ordinariats nicht zu einer Lösung, dann trifft der (Erz-) Bischof eine Entscheidung.
Bevor jemand Beschwerde einlegt, muss er die Rücknahme oder Abänderung der Entscheidung schriftlich beim Ordinariat beantragen. Can. 1743ff CIC gelten entsprechend. Die Beschwerde ist beim (Erz-)Bischof als oberstem Richter in der (Erz-)Diözese zu erheben (can. 391 CIC).
3.
Vergütung und Versorgung
der hauptberuflichen Ständigen Diakone
§ 23
Grundsätzliche Regelung
Zur Regelung der Vergütung sowie der Alters- und der Hinterbliebenenversorgung der hauptberuflichen Ständigen Diakone wird mit der Weihe ein Arbeitsvertrag eigener Art geschlossen, wie er in der jeweiligen (Erz-)Diözese für nichtinkardinierte Priester üblich ist.
§ 24
Vergütung
(1) Der Diakon im Hauptberuf erhält seine Vergütung ab dem Weihetag bzw. ab dem Zeitpunkt der Übernahme in den hauptberuflichen Dienst, wenn er zuvor Diakon mit Zivilberuf war.
Die Höhe der Vergütung ergibt sich aus der Anlage 1. Sie wird regelmäßig an die Entwicklung der Vergütung pastoraler Mitarbeiter/-innen in der (Erz-)Diözese angepasst.
(2) Es werden folgende Vergütungsgruppen unterschieden:
Gruppe
D 1 a: Diakone bis zur 2.
Dienstprüfung mit
- diözesaner Ausbildung
oder
- entsprechendem
Studienabschluss einer Fachhoch-
schule als
Religionspädagoge, Sozialpädagoge
oder
- mit erstem Staatsexamen
in katholischer Religions-
lehre.
Gruppe D 1 b: Diakone der Gruppe D 1 a nach der 2. Dienstprüfung.
Gruppe D 1 c: Diakone der Gruppe D 1 b nach 11-jähriger Bewährung.
Gruppe
D 2 a: Diakone bis zur 2.
Dienstprüfung mit
- theologischem
Diplom/Lizentiat einer Hochschule
bzw. Universität
oder
- zweitem Staatsexamen in
katholischer Religions-
lehre.
Gruppe D 2 b: Diakone der Gruppe D 2 a nach der 2. Dienstprüfung.
Gruppe D 2 c: Diakone der Gruppe D 2 b nach 11-jähriger Bewährung.
(vgl. hierzu auch Teil I, 4.3.1 7.)
(3) Die Vergütung umfasst:
1. die Grundvergütung,
2. den Ortszuschlag,
3. die Allgemeine Stellenzulage,
4. die Zuwendung („Weihnachtsgeld“),
5. das Urlaubsgeld,
6. ggf. „Ballungsraumzulage“.
Einzelheiten zu den Ziffern 1. – 5. sind in der Anlage 1 enthalten.
(4) Im Zölibat lebende Ständige Diakone im Hauptberuf erhalten auf Antrag zur Vergütung einer Haushälterin Zuschüsse nach den diözesanen Regelungen.
(5) Bei Übernahme in den hauptberuflichen kirchlichen Dienst („Vorbereitungsdienst“) werden künftige Ständige Diakone bis zur Weihe in der Regel zu 80% nach jener Gruppe vergütet, in die sie mit der Weihe eingestuft werden. Familienbezogene Bestandteile werden voll gewährt. Es wird ein bis zur Weihe befristeter Arbeitsvertrag geschlossen.
(6) Entsprechend dem Einkommen im bisherigen Zivilberuf wird eine soziale Besitzstandswahrung höchstens bis zur Höhe der Gruppe D 2 b gewährt. Bei Wahrung des Besitzstandes gilt die gewährte Vergütungsgruppe bis zum Eintritt in den Ruhestand bzw. bis zur Entpflichtung (vgl. Teil II, §§ 8 und 10). Wenn der Bewerber auf die Wahrung des sozialen Besitzstandes verzichtet, erfolgt die Vergütung gem. Teil II § 24 (2).
§ 25
Krankenversicherung, Beihilfe
(1) Der Diakon im Hauptberuf ist für den Krankheitsfall nach den gesetzlichen Bestimmungen bei einer Krankenkasse anzumelden.
(2) Der hauptberufliche Ständige Diakon erhält Beihilfe im Krankheits-, Geburts- und Todesfall nach den diözesanen Beihilfeordnungen.
§ 26
Versorgung
(1) Der hauptberufliche Ständige Diakon wird mit dem Empfang seiner Weihe nach Maßgabe seiner Vereinbarung mit der (Erz-)Diözese zur Regelung seiner Vergütung und Versorgung zur gesetzlichen Sozialversicherung (Renten-, Arbeitslosen-, Kranken-, Pflegeversicherung) angemeldet.
(2) Der Ständige Diakon im Hauptberuf wird ferner zu einer zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung gem. den Regelungen des Versorgungstarifvertrages für die Angestellten des öffentlichen Dienstes in seiner jeweiligen Fassung angemeldet. Inhalt und Umfang des Anspruchs richten sich nach der Satzung der Zusatzversorgungskasse, bei welcher die (Erz-)Diözese ihre Angestellten versichert.
(3) Im Falle einer einstweiligen Ruhestandsversetzung stellt die (Erz-)Diözese bis zur Aufhebung dieses Status oder bis zum Eintritt des Rentenfalles seine Versorgung, ggf. auch die seiner Familienangehörigen, sicher (vgl. Teil II § 8 Abs. 2).
(4) Die (Erz-)Diözese übernimmt den Arbeitnehmeranteil für die Arbeitslosenversicherung.
(5) Ist im Falle des frühzeitigen Todes eines Ständigen Diakons die Versorgung der Hinterbliebenen nicht ausreichend gewährleistet, übernimmt die (Erz-)Diözese den Unterschiedsbetrag bis zur Höhe von 60% der letzten Bruttovergütung. Eigene Einkünfte der Hinterbliebenen werden nach Maßgabe der gesetzlichen Regelungen mit der Unterstützung durch die (Erz-)Diözese verrechnet.
Den (Erz-)Diözesen steht es frei, ersatzweise eine entsprechende Risikolebensversicherung abzuschließen.
§ 27
Übergangsregelungen
(1) Innerhalb eines Jahres werden die bestehenden schriftlichen Ernennungs- sowie Versetzungsdekrete überprüft und, soweit erforderlich, dieser Ordnung angepasst.
(2) Die Ständigen Diakone werden schriftlich aufgefordert, ihre Tätigkeiten und Nebentätigkeiten außerhalb ihres diakonischen Dienstes unverzüglich anzugeben und ggf. um nachträgliche Genehmigung durch den (Erz-)Bischof zu bitten.
(3) Für alle, die im Jahr des Inkrafttretens der Dienst- und Vergütungsordnung das 70. Lebensjahr vollenden oder jünger sind, gilt die neue Regelung des § 8.
In allen anderen Fällen wird eine individuelle Übergangsregelung mit den Betroffenen abgesprochen. Übergangsregelungen sollen spätestens nach 3 Jahren auslaufen.
(4) Bestehende Mietverhältnisse (z.B. Dienstwohnung im Pfarrhaus) werden überprüft und der Neuregelung angepasst. Eine evtl. Neuberechnung erfolgt ein Jahr nach Inkrafttreten der Dienstordnung.
Binnen Jahresfrist werden die Bedingungen für einen angemessenen Arbeitsplatz gem. § 15 (3) überprüft und ggf. geändert.
(5) Die Regelungen des § 18 gelten ab dem folgenden Urlaubsjahr.
(6) Die Regelungen der §§ 24 mit 26 gelten ab dem 1. Juli 2000. Wird eine Tätigkeit in einer der neuen Vergütungsordnung vergleichbaren Höhe vergütet, ohne dass der betroffene Diakon die dafür erforderlichen Voraussetzungen erfüllt, wird er nicht zurückgestuft. Will dieser Ständige Diakon am Bewährungsaufstieg teilnehmen, muss er die 2. Dienstprüfung erfolgreich abgelegt haben.
Wo bisher Regelungen zur Besitzstandswahrung nicht angewandt wurden, kann die (Erz-)Diözese eigene Übergangsregelungen treffen.
§ 28
Inkrafttreten
(1) Diese Dienst- und Vergütungsordnung für Ständige Diakone in den bayerischen (Erz-)Diözesen tritt am 1. Juli 2000 in Kraft.
(2) Diese Ordnung ist im Amtsblatt jeder bayerischen (Erz-)Diözese zu veröffentlichen.
(3) Mit Inkrafttreten dieser Dienst- und Vergütungsordnung werden alle bisherigen Regelungen einer bayerischen (Erz-)Diözese, soweit sie dieser Ordnung entgegenstehen, aufgehoben.
Anlage 1
zum § 24 - Vergütung - der Bayerischen Dienstordnung
1.
Grundvergütung: (gültig ab 1.7.2000)
|
Alter |
35 |
37 |
39 |
41 |
43 |
45 |
47 |
49 |
|
D
1 a |
3759,- |
4007,- |
4132,- |
4256,- |
4273,- |
ab hier gleichbleibend |
|
|
|
D
2 a |
4684,- |
4855,- |
5026,- |
5198,- |
5369,- |
5532,- |
ab hier gleichbleibend |
|
|
D
1 b |
4256,- |
4413,- |
4570,- |
4726,- |
4883,- |
5037,- |
ab hier gleichbleibend |
|
|
D
2 b |
5127,- |
5328,- |
5529,- |
5730,- |
5930,- |
6131,- |
ab hier gleichbleibend |
|
|
D
1 c |
4684,- |
4855,- |
5026,- |
5198,- |
5369,- |
5532,- |
ab
hier gleichbleibend |
|
|
D
2 c |
5736,- |
5955,- |
6174,- |
6392,- |
6611,- |
6830,- |
7048,- |
ab
hier gleichbleibend |
2.
Ortszuschlag: (gültig ab 1.7.2000)
Der Ortszuschlag (Monatsbeträge in DM) beträgt für die Gruppen:
|
|
ledig |
verheiratet |
mit
einem Kind |
|
D
1 a bis D 1 c und D 2 a |
900,56 |
1092,18 |
1254,54 |
|
D
2 b bis D 2 c |
1013,31 |
1204,93 |
1367,29 |
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für jedes weitere zu berücksichtigende Kind um DM 162,36. Die Berücksichtigung von Kindern erfolgt in sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen für die Angestellten der (Erz-)Diözese.
3.
Urlaubsgeld
Es wird in Anlehnung an die Regelungen für die Angestellten der (Erz-) Diözese in ihrer jeweils geltenden Fassung gewährt und beträgt derzeit DM 500,-.
4.
Zuwendung
Sie wird entsprechend den Regelungen für die Angestellten der (Erz-) Diözese in ihrer jeweiligen Fassung gewährt.
5.
Allgemeine Stellenzulage: (gültig ab 1.7.2000)
Es wird eine allgemeine Stellenzulage in folgender Höhe gewährt (Monatsbeträge in DM):
|
D
1 a |
D
2 a |
D
1 b |
D
2 b |
D
1 c |
D
2 c |
|
205,45 |
205,45 |
205,45 |
205,45 |
205,45 |
77,03 |
Anlage 2
Urlaubsregelungen für hauptberufliche Ständige Diakone (Teil II, § 18)
(1)
Erholungsurlaub
1. Der hauptberufliche Ständige Diakon erhält in Anlehnung an can. 533 § 2 CIC in jedem Urlaubsjahr 31 Kalendertage Erholungsurlaub. Urlaubsjahr ist das Kalenderjahr.
2. Der Urlaubsanspruch beginnt mit dem Monat der Weihe. Beginnt oder endet das Dienstverhältnis im Laufe des Urlaubsjahres, so beträgt der Urlaubsanspruch ein Zwölftel für jeden, auch angefangenen Monat.
3. Urlaub, der dem Ständigen Diakon in einem früheren Beschäftigungsverhältnis für Monate gewährt worden ist, die in sein jetziges Dienstverhältnis fallen, wird auf den Urlaub angerechnet.
4. Der Urlaub soll grundsätzlich zusammenhängend gewährt werden. Er kann auf Wunsch des Ständigen Diakons in zwei Teilen genommen werden; dabei muss jedoch ein Urlaubsteil so bemessen sein, dass er mindestens für zwei volle Wochen vom Dienst befreit ist.
Erkrankt der Ständige Diakon während des Urlaubs und zeigt er dies unverzüglich an (vgl. Teil II, §17 (1)), so werden die durch ärztliches Zeugnis nachgewiesenen Krankheitstage, an denen er arbeitsunfähig war, auf den Urlaub nicht angerechnet. Er hat sich nach planmäßigem Ablauf seines Urlaubs oder, falls die Krankheit länger dauert, nach Wiederherstellung der Dienstfähigkeit zum Dienst zu melden. Der Antritt des restlichen Urlaubs wird neu festgesetzt.
5. Der Urlaub ist spätestens bis zum Ende des Urlaubsjahres anzutreten.
Kann der Urlaub bis zum Ende des Urlaubsjahres nicht angetreten werden, ist er bis zum 30. April des folgenden Urlaubsjahres anzutreten. Kann der Urlaub aus pastoralen Gründen oder wegen Arbeitsunfähigkeit nicht bis zum 30. April angetreten werden, ist er bis zum 30. Juni anzutreten.
Urlaub, der nicht innerhalb der genannten Fristen angetreten ist, verfällt.
6. Scheidet der Ständige Diakon wegen Berufsunfähigkeit oder Erwerbsunfähigkeit oder durch Erreichung der Altersgrenze aus dem Dienstverhältnis aus, so beträgt der Urlaubsanspruch sechs Zwölftel, wenn das Dienstverhältnis in der ersten Hälfte, und zwölf Zwölftel, wenn es in der zweiten Hälfte des Urlaubsjahres endet.
7. In den bayerischen (Erz-)Diözesen wird von der Kürzungsmöglichkeit des Jahresurlaubs gem § 17 Bundeserziehungsgeldgesetz Gebrauch gemacht, wenn der Ständige Diakon den Erziehungsurlaub in Anspruch nimmt.
8. Für die Gewährung eines Zusatzurlaubs für Schwerbehinderte gelten die Bestimmungen des Schwerbehindertengesetzes.
Nach den Hochfesten des Kirchenjahres (Weihnachten, Ostern und Pfingsten) können, wenn damit für den Ständigen Diakon besondere Arbeitsbelastungen verbunden waren, jeweils bis zu drei zusätzliche Erholungstage genommen werden. Falls dies in Absprache mit dem unmittelbaren Dienstvorgesetzten aus pastoralen Gründen nicht möglich ist, können diese zusätzlichen Tage auch zu einem anderen, den Hochfesten nahegelegenen Zeitpunkt genommen werden.
(2)
Sonderurlaub
1. Der Ständige Diakon kann bei Vorliegen eines wichtigen Grundes unter Verzicht auf die Bezüge Sonderurlaub erhalten, wenn die dienstlichen oder betrieblichen Verhältnisse es gestatten. Voraussetzung ist, dass die (Erz-)Diözese ein dienstliches oder pastorales Interesse an der Beurlaubung hat.
2. Der Ständige Diakon kann wegen der Erziehung eines Kindes oder wegen der Pflege oder der Betreuung eines pflegebedürftigen Angehörigen Sonderurlaub von jeweils bis zu fünf Jahren erhalten, wenn die dienstlichen, insbesondere pastoralen Verhältnisse es gestatten. Eine Verlängerung kann gewährt werden.
Sonderurlaub wegen Kindererziehung kann gewährt werden, wenn er mindestens ein Kind bis zum Ende des schulpflichtigen Alters tatsächlich betreut. Sonderurlaub wegen Kindererziehung kann längstens bis zu insgesamt zwölf Jahren gewährt werden.
3. Ständige Diakone, die gem. Abs. 1 und 2 beurlaubt sind, können den Sonderurlaub durch Erziehungsurlaub unterbrechen, wenn ihnen während des Sonderurlaubes gem. §15 Abs. 1 Satz 1 Bundeserziehungsgeldgesetz Erziehungsurlaub zusteht.
Die Wiederaufnahme der Beschäftigung erfolgt zu dem für das Ende des Sonderurlaubes vorgesehenen Termin, es sei denn, der Erziehungsurlaub überschreitet das vorgesehene Ende des beantragten Sonderurlaubes.
Der Sonderurlaub kann auch in zeitlichen Abständen genommen werden.
(3)
Dienstbefreiung
1. Aus folgenden Anlässen erhält ein Ständiger Diakon Dienstbefreiung:
aa)
eines Angehörigen, soweit er in demselben Haushalt lebt,
1 Arbeitstag/Jahr
bb)
eines Kindes, das das 12. Lebensjahr noch nicht
vollendet hat, wenn im laufenden Kalenderjahr
kein Anspruch nach § 45 SGB V besteht
oder bestanden hat,
4 Arbeitstage/Jahr
cc)
einer Betreuungsperson, wenn der Ständige Diakon
deshalb die Betreuung seines Kindes, das das
8. Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder
wegen körperlicher, geistiger oder seelischer
Behinderung dauernd pflegebedürftig ist,
übernehmen muss
4 Arbeitstage/Jahr
Eine Freistellung erfolgt nur, soweit eine andere Person zur Pflege oder zur Betreuung nicht sofort zur Verfügung steht und der Arzt in den Fällen der Doppelbuchstaben aa und bb die Notwendigkeit der Anwesenheit des Ständigen Diakons zur vorläufigen Pflege bescheinigt. Die Freistellung darf insgesamt fünf Arbeitstage im Kalenderjahr nicht überschreiten.
- Ärztliche Behandlung des Ständigen Diakons, wenn diese während der Dienstzeit erfolgen muss.
2. Dem Ständigen Diakon kann in sonstigen dringenden Fällen Dienstbefreiung unter Fortzahlung der Vergütung bis zu drei Arbeitstagen gewährt werden.
In begründeten Fällen kann bei Verzicht auf die Bezüge kurzfristige Dienstbefreiung gewährt werden, wenn die dienstlichen oder pastoralen Verhältnisse es gestatten.
(4)
Verfahrensregelungen
1. Der Antrag auf Genehmigung des Urlaubs ist im (Erz-)bischöflichen Ordinariat (Personalreferat) vorzulegen. Studienreisen sowie länger als drei Tage dauernde Gruppenfahrten/Pilgerfahrten o.ä. in der Dienstzeit bedürfen der Genehmigung durch das (Erz-)bischöfliche Ordinariat. Sonstige Abwesenheiten (1 Woche Fortbildung, l Woche Exerzitien) sind dem (Erz-)bischöflichen Ordinariat anzuzeigen.
2. Alle Abwesenheiten vom Dienstort, sei es aus Urlaubsgründen oder aus einem der obengenannten Gründe, sind auch dem zuständigen unmittelbaren Dienstvorgesetzten zu melden. Seine Kenntnisnahme und Zustimmung ist auf dem Antrag zu vermerken.
3. Ständige Diakone, die Unterrichtsverpflichtungen in der Schule haben, sind verpflichtet, bei nicht krankheitsbedingter Abwesenheit für eine Vertretung zu sorgen.
4. Abweichungen von der Urlaubsregelung bedürfen der Genehmigung durch das (Erz-)Bischöfliche Ordinariat.
Anlage 3
zu Teil I Ziffer 4 - Ausbildung, Berufseinführung
und Fortbildung - der Rahmenordnung der DBK und der Bayerischen Dienstordnung
Empfehlungen
zur Vereinheitlichung der Strukturen in den einzelnen Diözesen1
Um einen besseren Austausch im Bereich des Ständigen Diakonats unter den (Erz-)Diözesen zu ermöglichen, empfiehlt es sich, die Strukturen in den einzelnen (Erz-)Diözesen einander wie folgt anzupassen:
1. Der Bischöfliche Beauftragte trägt Verantwortung für alle Belange des Ständigen Diakonates in der (Erz-)Diözese. Insbesondere hat er die persönliche Qualifikation der Interessenten/Bewerber festzustellen und deren ordnungsgemäßen Weg zur Diakonenweihe zu gewährleisten. Er begleitet die neugeweihten Diakone auch während der Phase der Berufseinführung und verantwortet die Fortbildung aller Diakone. Darüber hinaus ist der Bischöfliche Beauftragte auch für den pastoralen Einsatz der Ständigen Diakone zuständig. In diesem Fall legt es sich besonders nahe, dass der Personalreferent der (Erz-)Diözese zugleich auch der Bischöfliche Beauftragte für die Ständigen Diakone ist. Ansonsten ist eine enge Zusammenarbeit mit dem Personalreferenten (auch in Kooperation mit den Personalverantwortlichen der anderen pastoralen Berufe) notwendig.
Das Anliegen der Ständigen Diakone soll in geeigneter Weise im Geistlichen Rat bzw. in der Ordinariatssitzung personell vertreten werden.
2. Innerhalb des Personalreferates wird eine Arbeitsstelle/ein Fachbereich Ständiger Diakonat errichtet, die/der je nach Anzahl der Interessenten/Bewerber/ Kandidaten und Ständigen Diakone mit den erforderlichen Kräften besetzt ist. Als deren/dessen Leiter bietet sich ein Ständiger Diakon an.
Aufgaben des Bischöflichen Beauftragten und/oder Personalreferenten können ganz oder teilweise an den Leiter der Arbeitsstelle/des Fachbereiches delegiert werden. Dieser nimmt weisungsgemäß die Aufgaben im Einzelnen wahr.
3. Die Diakonatskommission hat die Aufgabe, die Verantwortlichen für den Ständigen Diakonat bei der Beurteilung der Bewerber und Weihekandidaten sowie in Fragen der Nachwuchsförderung und Berufsentwicklung, der Akzeptanz und des Berufsprofils des Ständigen Diakons zu beraten und zu unterstützen.
Als Mitglieder empfehlen sich je nach
Arbeitsschwerpunkt: der Generalvikar, der Bischöfliche Beauftragte, ggf. der
Personalreferent, der Seelsorgereferent der (Erz-)Diözese, der
Fachbereichs-/Arbeitsstellenleiter, Mentoren/Leiter der Diakonatskreise,
Vertreter aus dem Bereich der
Aus-/Fortbildung, der Sprecher der Ständigen Diakone.
Die Kommission tagt in der Regel zweimal im Jahr.
4. Sprecherrat und Diözesansprecher der Ständigen Diakone
Alle Ständigen Diakone und ihre Ehefrauen wählen für die Dauer von vier Jahren jeweils ihre VertreterInnen in den Sprecherrat,
- sich der Förderung des Ständigen Diakonates verpflichtet weiß,
- grundlegende Reflexionen zum Ständigen Diakonat in der (Erz-) Diözese anregt und begleitet.
Der Sprecherrat setzt sich aus einer angemessenen Zahl von Diakonen im Hauptberuf, mit Zivilberuf und hauptberuflichen Diakonen im Ruhestand zusammen. Die Ehefrauen der Ständigen Diakone wählen zwei Vertreterinnen aus ihrem Kreis; sie gelten als Ansprechpartnerinnen und können fallweise zu den Sitzungen eingeladen werden.
Der Diözesansprecher ist Ständiger Diakon. Er und sein Vertreter werden entweder aus dem Sprecherrat und von ihm oder aus und von allen Ständigen Diakonen gewählt; im letzteren Fall sind beide Mitglieder des Sprecherrates. Die Übernahme der Aufgabe als Diözesansprecher soll bei der zeitlichen Festlegung des Dienstumfanges berücksichtigt werden (vgl. Teil I, Ziff. 4 und Teil II § 20).
Die vorliegende Dienst- und Vergütungsordnung für Ständige Diakone in den bayerischen (Erz-)Diözesen wurde von den bayerischen (Erz-) Bischöfen am 30. März 2000 beschlossen. Sie wird hiermit rückwirkend zum 1. Juli 2000 für die Diözese Augsburg in Kraft gesetzt.
In der von den bayerischen (Erz-)Bischöfen zum 1. Juli 2000 in Kraft gesetzten Dienst- und Vergütungsordnung für Ständige Diakone werden für die Diözese Augsburg die nachfolgenden Ausführungsbestimmungen erlassen:
Teil II
Zu § 4 (5)
Ein Zugang zum Ständigen Diakon im Hauptberuf ohne vorherige mehrjährige Tätigkeit als Diakon mit Zivilberuf ist in der Diözese Augsburg nicht möglich.
Zu § 8 Abs. 1 und 3
Die für Priester geltende Altersgrenze wurde durch die „Richtlinien für den Eintritt in den Ruhestand der Priester im Dienste der Diözese Augsburg vom 20. Februar 1976 (Amtsblatt 1976, S. 112 ff.) auf die Vollendung des 70. Lebensjahres festgelegt. Diese Regelung gilt entsprechend auch für Ständige Diakone.
Zu § 13 Abs. 2
Das Regelstundenmaß beträgt für hauptberuflich vollbeschäftigte Ständige Diakone im pfarrlichen Dienst für den schulischen Religionsunterricht an Grund-, Haupt- und Förderschulen sechs Stunden.
Zu § 15 Abs. 2
Bei
Zuweisung einer Dienstwohnung gilt die kirchliche Dienstwohnungsordnung KiDWO
vom 15.05.2001, veröffentlicht im Amtsblatt der Diözese Augsburg Nr. 7/2001,
S. 237 ff.
Zu § 17
Für Fort- und Weiterbildung sowie Exerzitien gelten die diözesanen Regelungen der Diözese Augsburg in der jeweils gültigen Fassung (derzeit Ordnung für die Fortbildung/Weiterbildung/Zusatzausbildung für Priester und Ständige Diakone sowie Pastoralreferenten/-innen, Gemeindereferenten/-innen, Pfarrhelfer/-innen im pastoralen Dienst der Diözese Augsburg, Amtsblatt Nr. 6/1999, S. 181 ff.).
Zu § 24 Abs. 4
Die Regelung der Zuschüsse, die zur Vergütung einer Haushälterin bei Priestern gewährt werden, findet entsprechend auch Anwendung bei Ständigen Diakonen.
Zu § 25 Abs. 2
Es gilt die Beihilfeordnung der Diözese Augsburg, veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 3/2000, S. 79 ff.
Diese Ausführungsbestimmungen treten
zum 01.01.2002 in Kraft.
Kohler
Heigl
Generalvikar
Domkapitular
[1] Die deutschen Bischöfe, Heft 50, hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn, 1994, in dem die maßgeblichen Bestimmungen des CIC berücksichtigt sind.
[2]
Weitere Grundlagen sind:
- Grundnormen für die Ausbildung für die Ständigen Diakone.
- Direktorium für den Dienst und das Leben der Ständigen Diakone.
Beide veröffentlicht in: Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls vom
22.Februar 1998 (Heft Nr. 132).
Die Empfehlungen der Deutschen Bischofskonferenz vom 22/23. November 1999
zur Umsetzung der römischen „Grundnormen“ und des römischen „Direktorums“.
[3]
Vgl. Der liturgische Dienst des Diakons. Handreichung der
Liturgiekommission zum sinngerechten Vollzug der gottesdienstlichen Aufgaben
des Diakons, hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn,
1984.
[4] Vgl. Richtlinien über die persönlichen Anforderungen an Diakone und Laien im pastoralen Dienst im Hinblick auf Ehe und Familie, Heft 55, hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn, 1995.
[5]
Vgl. Richtlinien
über die persönlichen Anforderungen an Diakone und Laien im pastoralen
Dienst im Hinblick auf Ehe und Familie, Heft 55, hrsg. vom Sekretariat der
Deutschen Bischofskonferenz, Bonn, 1995.
[6] Der Zuschuss beträgt in der Regel 50%.
[7] Vgl.
Sacrum Diaconatus Ordinem 30.
[8] Die Pauschale beträgt derzeit DM 350,--.
[9] Vgl. cc. 1311-1399 CIC.
[10] Die Kirchliche Arbeitszeitordnung (KAZO) vom 1.5.1997 wird aufgrund des besonderen Dienstverhältnisses Ständiger Diakone nicht angewendet.
[11] Vgl. Sacrum Diakonatus Ordinem 28.
[12] Vgl. Teil I, Ziff. 4.3.2 „Fortbildung des Diakons mit Zivilberuf“.
[13] Vgl. Der pastorale Dienst in der Pfarrgemeinde, II. Nr. 2.4.
und 3.2, Heft 54, hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz,
Bonn, 1995.
[14] Vgl. hierzu can. 517 § 2
CIC.
[15]
Vgl. Der pastorale Dienst in der Pfarrgemeinde, II. Nr. 2.4. und 3.2,
Heft 54, hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn, 1995.
[16] Vgl. Teil I, Ziff. 4.1 „Diakonatskreise und
Diakonenkreise“.
[17] Vgl. Beschluss der Konferenz der bayerischen Bischöfe vom 30./31. März 1971.
1 Vordienstzeiten
im kirchlichen Dienst werden angerechnet.
1 Diese
Empfehlungen wurden in Anlehnung an die „Rahmenordnung für Ständige
Diakone in den Bistümern der Bundesrepublik Deutschland“ und in analoger
Umsetzung der „Grundnormen für die Ausbildung für die Ständigen
Diakone“ sowie des „Direktorium für den Dienst und das Leben der Ständigen
Diakone“ erstellt (vgl. auch die „Empfehlungen der Deutschen Bischöfe
zur Umsetzung der „Grundnormen“ und des „Direktoriums“ vom 22./23.
November 1999). Sie geben auch die Erfahrungen wieder, die in
jahrzehntelanger Praxis in Bayerischen (Erz-)Diözesen gemacht wurden.